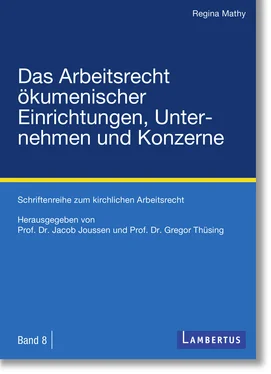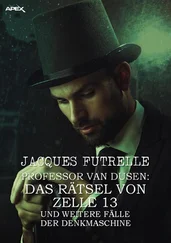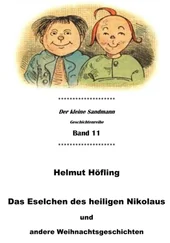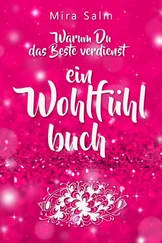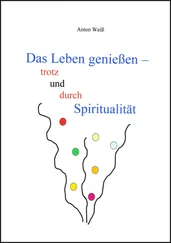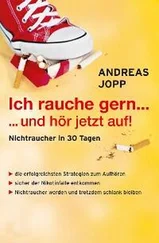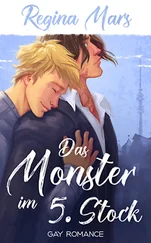4. Ein Blick auf § 118 Abs. 2 BetrVG
5. Sonderfall: Kirchliche Stiftungen
6. Zwischenergebnis
III. Zarter Richtungsweiser: Die Rechtsprechung
1. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
a) Teilhabe an der Verwirklichung eines Stückes des Auftrags der Kirche
b) Neutralitätspflicht des Staates
2. Rechtsprechung der Arbeitsgerichte
a) Zuordnung verselbstständigter Einrichtungen
b) Parallele: Zuordnung weltlich-kirchlicher Einrichtungen
3. Rechtsprechung anderer Fachgerichte
a) BGH zum kirchlichen Mitgliedschaftsrecht
b) BSG zur kirchlichen Fachambulanz
c) BVerwG zur Reichweite des Selbstbestimmungsrechts
d) FG Hamburg zur steuerrechtlichen Privilegierung von Kirchen
4. Zwischenergebni s
IV. Vereinbarkeit mit geltendem Unionsrecht
V. Fazit
C. Zuordnung verselbstständigter ökumenischer Einrichtungen
I. Besonderheit: Ökumenische Einrichtungen
1. Notwendigkeit der Zuordnung ausschließlich zu einer Kirche
2. Zuordnung zu beiden Kirchen
3. Zuordnung zu mindestens einer Kirche
II. Erste Voraussetzung: Erfüllung eines kirchlich-diakonischen Auftrags
III. Zweite Voraussetzung: Verbundenheit mit der Kirche
1. Indiz: Allein- oder Mehrheitsgesellschafterstellung
2. Indiz: Personelle Besetzung willensbildender Organe
a) Vorstand und Aufsichtsrat
b) Sonstige Gremien
c) Leitende Mitarbeiter
d) Kirchlicher Einfluss durch Laien?
3. Indiz: Statut
a) Verankerung des kirchlichen Propriums
b) Ausgestaltung der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrags
4. Indiz: Aufsichtsrecht bzw. Genehmigungsvorbehalt kirchlicher Oberbehörden
5. Indiz: Verbandsmitgliedschaft
a) Problem der Doppelmitgliedschaft
b) Assoziierte korporative Mitgliedschaft bzw. Gastmitgliedschaft
c) Verzicht auf Mitgliedschaft in einem kirchlichen Wohlfahrtsverband
d) Sonderfall: Ökumenische Arbeitsgemeinschaft als Spitzenverband
6. Indiz: Anwendungspflicht für das Kirchliche (Arbeits-)Recht
7. Weitere Indizien
IV. Dritte Voraussetzung: Keine vorwiegende Gewinnorientierung
V. Gerichtliche Überprüfbarkeit
VI. Zwischenergebnis
§ 4 Kirchenrechtliche Anerkennung ökumenischer Einrichtungen
A. Ökumenisches Kirchenrecht?
I. Das Wesen des Kirchenrechts
II. Rechtsquellen des Kirchenrechts
1. Kanonisches Recht der katholischen Kirche
a) Struktur der katholischen Kirche
b) Gesetzgebungskompetenz
2. Evangelisches Kirchenrecht
a) Struktur der evangelischen Kirchen
b) Gesetzgebungskompetenz der Synoden
III. Kirchenrechtliche Selbstverpflichtung zur Ökumene
1. Katholische Kirche
2. Evangelische Kirchen
3. Zwischenergebnis
B. Kirchliches Arbeitsrecht und Ökumene
I. Rechtsquellen für geltende Loyalitätspflichten
1. Katholische Kirche: GrO
2. Evangelische Kirchen: LoyalitätsRL-EKD
II. Mitarbeitervertretungsrecht
1. Katholische Kirche: MAVO
2. Evangelische Kirche: MVG-EKD
III. Arbeitsrechtsregelung
1. Katholische Kirche: KODA-Ordnungen
2. Evangelische Kirche: ARRG und ARGG-EKD
IV. Kircheneigene Arbeitsgerichtsbarkeit
1. Katholische Kirche: KAGO
2. Evangelische Kirche: MVG-EKD und KiGG.EKD
V. Die „Dienstgemeinschaft“ als allgemeines Leitbild
C. Anwendbarkeit der Ordnungen des kirchlichen Arbeitsrechts auf ökumenische Einrichtungen
I. Rechtsqualität der Ordnungen des kirchlichen Arbeitsrechts
II. Anwendung des katholischen kirchlichen Arbeitsrechts auf ökumenische Einrichtungen
1. Grundordnung
a) „Kirchlicher Rechtsträger“ i.S.d. GrO
b) Rechtsfolgen einer fehlenden verbindlichen Übernahme der GrO
2. MAVO
3. Arbeitsvertragsrichtlinien
III. Anwendung des evangelischen Kirchlichen Arbeitsrechts auf ökumenische Einrichtungen
1. LoyalitätsRL-EKD
a) Keine unmittelbare Anwendbarkeit
b) Fakultative Anwendbarkeit
2. MVG-EKD
3. Arbeitsvertragsrichtlinien
D. Stellungnahme
§ 5 Vergleich von katholischem und evangelischem kirchlichen Arbeitsrecht
A. Selbstbestimmungsrecht und (kirchliches) Arbeitsrecht
I. „Kirchliches Arbeitsrecht“
1. Begriffsverständnis
2. Abgrenzung zu Personen, die aufgrund eines besonderen Rechtsverhältnisses zur Kirche tätig sind
II. Rechtsquellen des staatlichen Rechts für das kirchliche Arbeitsrecht
1. Grundrechtsverpflichtung der Religionsgemeinschaften
2. Unionsrechtliche Vorgaben für das kirchliche Arbeitsrecht
3. Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
4. Zwingende einfachrechtliche Vorgaben
III. Zwischenergebnis
B. Individualarbeitsrecht – Loyalitätspflichten des kirchlichen Dienstes
I. Loyalitätspflichten als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts
1. Verfassungsrechtliche Ermächtigung
2. Eingeschränkte Überprüfungskompetenz staatlicher Gerichte
a) Unionsrechtliche Implikationen
b) Rechtsprechung des EGMR
II. Rechtsquellen und deren Geltungsbereich
1. Geltungsbereich
2. Grundprinzipien
III. Begründung des Arbeitsverhältnisses
1. Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit
2. Aufklärungspflicht
3. Zwischenergebnis
IV. Loyalitätspflichten kirchlicher Mitarbeiter
1. Differenzierungskriterien
2. Unterschiede zwischen den katholischen und evangelischen Loyalitätspflichten
a) Allgemeine Loyalitätspflichten für alle Mitarbeiter
b) Loyalitätspflichten von Mitarbeitern der jeweiligen Konfession
c) Loyalitätspflichten christlicher Mitarbeiter
d) Loyalitätspflichten nicht-christlicher Mitarbeiter
e) Besondere Loyalitätspflichten
3. Zwischenergebnis
V. Folgen von Verstößen gegen Loyalitätspflichten
1. Schwerwiegende Verstöße gegen Loyalitätspflichten
a) Kirchenaustritt
b) Kirchenfeindliches Verhalten
c) Besondere Anforderungen an katholische Mitarbeiter nach der GrO
2. Kündigung als ultima ratio
a) Gesetzliche Grenzen im Verhältnis zum Selbstbestimmungsrecht der Kirche
b) Abwägung der Einzelfallumstände
c) Verfahren
3. Zwischenergebnis
VI. Wesentliche Unterschiede zwischen beiden Ordnungen
1. Nicht-katholische christliche Mitarbeiter in einer der GrO unterfallenden Einrichtung
2. Katholische Mitarbeiter in einer der LoyalitätsRL-EKD unterfallenden Einrichtung
VII. Zwischenergebnis – Divergierende Loyalitätspflichten
C. Kollektivarbeitsrecht – Mitarbeitervertretungsrecht
I. Kircheneigenes Mitarbeitervertretungsrecht als Ausdruck autonomer Rechtsetzungsbefugnis
1. Verfassungsrechtlich gebotene Freistellung vom staatlichen Betriebsverfassungsrecht
2. Unionsrechtliche Implikationen
II. Rechtsquellen und Terminologie
1. Vergleichsgrundlage
2. Terminologie
a) Einrichtung bzw. Dienststelle
b) Mitarbeiter
c) Dienstgeber bzw. Rechtsträger
d) Personen in leitender Stellung bzw. Dienststellenleitung
e) Mitarbeitervertretung
f) Mitarbeiterversammlung
3. Zugrundeliegendes Verständnis – Die Präambeln
III. Geltungsbereich
1. Räumlicher Geltungsbereich
2. Sachlicher Geltungsbereich
a) Grundsatz: Einrichtungen bzw. Dienststellen
b) Ausnahmen vom Grundsatz
3. Persönlicher Geltungsbereich
a) Dienstgeber bzw. Rechtsträger
b) Mitarbeiter
IV. Wesentliche Unterschiede beider Ordnungen
1. Mitarbeiterversammlung
a) Aufgaben
b) Teilnahmerecht
Читать дальше