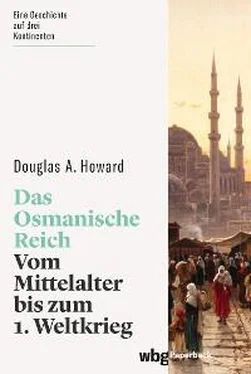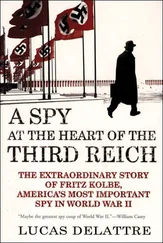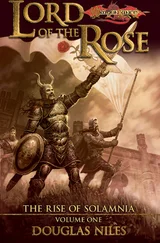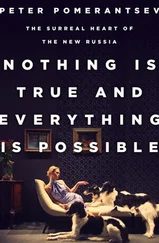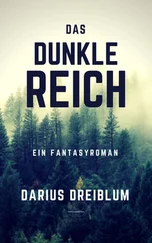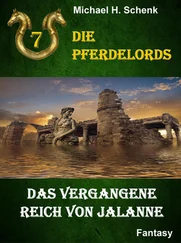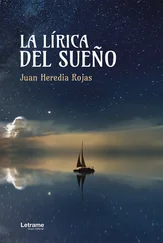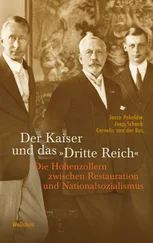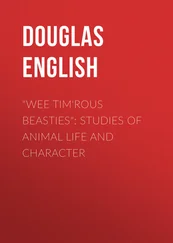Das Zeitempfinden einer Gesellschaft ist ein geeigneter Ausgangspunkt für den Einstieg in ihre Weltsicht. Daher erzählt dieses Buch die Geschichte der Osmanen in sieben chronologischen Kapiteln, entsprechend den Jahrhunderten des islamischen Kalenders, jener Zeitrechnung, die mit der Hidschra des Propheten Mohammed begann (622 n. Chr.). Zwar waren in den Ländern der osmanischen Dynastie und den von ihr beherrschten Gemeinschaften auch andere Kalender gebräuchlich, aber die Osmanen hielten sich an diesen islamischen Kalender und verwendeten ihn im gesamten Reich als Standard. Kapitel 1beginnt mit dem Auftreten Osmans zu Beginn des achten islamischen Jahrhunderts, und Kapitel 7endet mit dem Abgang der osmanischen Dynastie in der Mitte des vierzehnten. Somit vertritt das Buch zwei Thesen. Die eine lautet, dass das Dramatische an der Geschichte gerade in ihrer Chronologie besteht. Die Menschen wissen nie, was als Nächstes geschehen wird, sie wissen bloß, was gerade passiert ist, und auch das nur verschwommen. Da es der Historiker ist, der am Ende die Geschichte erzählt, ist die geschehende Geschichte von Natur aus anachronistisch. Dieses Paradox ist Teil des Vergnügens. Die andere These, die in der chronologischen Anordnung des Buches steckt, besagt, dass das Erleben von Zeit selbst eine Dimension der erzählten Geschichte ist. Keine Epoche ist wichtiger oder unwichtiger als eine andere. Ein kulturelles Konstrukt des Menschen, das ihm kosmologische Orientierung bietet und eine Struktur an die Hand gibt, innerhalb derer er den Sinn des Lebens begreifen kann, ist der Kalender.
Der Aufbau des Buches ist der osmanischen Weltsicht noch auf zwei weitere Arten verpflichtet, nämlich durch den Gebrauch einheimischer Ortsnamen und den Gebrauch von Eigennamen. Ortsnamen benennen das Terrain, das die osmanischen Völker ständig durchquerten, geben den Schauplatz der Handlung vor und liefern zum Teil den Kontext der Ereignisse. Mehr noch, sie lassen die Gestalt der osmanischen Gedankenwelt erkennen; es kann gar nicht genug betont werden, dass die Osmanen die regionale Vielfalt als gegeben annahmen. Sie hatten ihre Freude daran. Sie hüteten sich davor, Pauschalurteile auf der Grundlage von Verallgemeinerungen zu fällen, wie etwa „der osmanische Balkan“ – so etwas gab es nicht – oder „Anatolien“, dessen heutige Definition ebenfalls ziemlich jungen Datums ist und nach dem Ende des Imperiums entstand. Osmanische Autoren sprachen von „diesen wohlbeschützten Herrschaftsbereichen“, über die sie mit eigentümlicher Betonung des Lokalen berichteten.
Was die Eigennamen angeht, so sind viele von ihnen vielleicht nicht vertraut, doch sie sind trotzdem unverzichtbar. Dieses Buch handelt von Menschen und von den Entscheidungen, die sie trafen, von dem, was sie schrieben und sagten, wie sie mit Leid fertig wurden, welche Überraschungen sie erlebten und was sie glücklich machte. Die Osmanen liebten es, alles zu dokumentieren, weshalb die Quellen, auf denen das Buch beruht, tatsächlich Namen nennen. Natürlich kannten viele Angehörige der vergleichsweise kleinen osmanischen Herrschaftsschicht einander, besonders jene, die gemeinsam im Palast aufgewachsen waren, aber das reicht als Erklärung nicht aus, da es nicht nur die Herrschaftsschicht ist, deren Namen in den Dokumenten auftauchen. Auch einfache Leute erscheinen namentlich, Männer wie Frauen, Christen, Juden, Muslime und Fremde, in Beschwerden und Gesuchen, Gerichtsfällen, Verträgen, Tagebüchern, Geschichtswerken und ähnlichem. Vielleicht stellen diese Namen die Geduld des Uneingeweihten auf die Probe, aber wer gut vorbereitet ist, dem offenbaren osmanische Namen häufig wichtige Informationen – Geschlecht, soziale Identität, Herkunftsort –, ganz abgesehen davon, dass sie manchmal schillernd und kurzweilig sind. Wenn in diesem Buch viele dieser Namen enthalten sind, so ist das der Versuch zu wiederholen, was die historischen Aufzeichnungen der Osmanen überdeutlich machen: dass die osmanische Weltsicht am klarsten in der Achtung vor dem Einzelnen und vor den bedeutsamen wie den banalen Details seines Lebens zum Ausdruck kam.
1. Osmanische Genese, 1300–1397
Der Regen fiel heftig in diesem Frühjahr, und der Fluss Sangarios trat über die Ufer und suchte sich unter einer längst aufgegebenen Brücke hindurch sein altes Bett. Ein Sturzbach aus Matsch, Schlamm und Schutt ergoss sich über den Weg, und dort begann das Osmanische Reich, in den westlichen Grenzregionen der mongolischen Welt während der Morgenröte der Kleinen Eiszeit, im Monat März an der Wende zum achten islamischen Jahrhundert. Türkischen Hirten, die mit ihren Herden von den regengepeitschten Anhöhen flohen, gelang es, die durchbrochenen byzantinischen Verteidigungslinien am abgerutschten Flussufer zu umgehen. 1Ihre Vorhut überraschte eine byzantinische Streitmacht. Mit frischem Mut griffen die Türken an und brandschatzten. Es folgten zahlreiche weitere Raubzüge – eine wahre Flut. Von Konstantinopel rückte das reguläre Heer aus, das vom Kaiser den Befehl erhalten hatte, der türkischen Gefahr entgegenzutreten, doch auf der Ebene von Bapheus vor Nikomedia errangen die Türken einen großen Sieg.
Osmanische Sultane des achten islamischen Jahrhunderts
| Osman |
gest. 1324(?) |
| Orhan |
1324–1361(?) |
| Murad I. |
1361(?)–1389 |
| Bayezid I. |
1389–1402 |
Nicht so schnell. Eine einzelne Schlacht macht noch kein Reich. Die frühesten erhaltenen türkischen Beschreibungen sind einhundert Jahre jünger, sie stammen aus einer Zeit, als die Erinnerungen an die Anfänge des Reiches bereits eng mit den Ansichten über die Art und Weise verknüpft waren, wie sich alles weiterentwickelt hatte. Und so trieb die osmanische Gründergeneration, losgelöst von der festen historischen Verankerung, in den Strudeln von Poesie und Epos aufs offene Meer hinaus. Selbst das Datum steht nicht ganz fest, was osmanischen Autoren nur recht war. Sie verlegten es gern ins Jahr 699 der Hidschra des Propheten Mohammed, als hätte das osmanische Herrscherhaus die Hoffnung auf den „Erneuerer des Zeitalters“ erfüllt, der zu Beginn eines jeden neuen Jahrhunderts erscheinen sollte. Und es war ein außerordentlicher Beginn – das islamische Jahr 700 entsprach beinahe genau dem christlichen Jahr 1300, eine bemerkenswerte Epochenüberschneidung.
Raubzüge und rauschende Fluten rühren im Türkischen von derselben verbalen Quelle her, und Tränen ebenso, nämlich von der Wurzel ak-, und viele spätere Autoren, Türken wie Griechen, kannten das Wortspiel. „Die Verstärkungen des rechten Glaubens rauschten über den Ungläubigen hinweg“, so geistreich der türkische Dichter Ahmedi, 2und der griechische Historiker Dukas schrieb: „Wenn sie die Stimme des Herolds vernehmen, der sie zum Angriff ruft – der in ihrer Sprache akin heißt –, brechen sie ungebeten herein wie ein über die Ufer tretender Fluss.“ 3
Fast nichts wissen wir heute über Osman, den Gründer des Hauses Osman, den Mann, der als Erster der Osmanensultane in Erinnerung ist. „Osman Bey trat in Erscheinung“, vermerkte ein lakonischer Annalist später. Niemand weiß, wann oder wo Osman geboren wurde, und lange Zeit gab es kein einziges Artefakt, das sich zuverlässig in seine Lebenszeit hätte datieren lassen. Inzwischen sind zwei Münzen aufgetaucht, eine in einer Privatsammlung in London und eine im archäologischen Museum von Istanbul; beide tragen die Prägung Osman ibn Ertugrul. 4Selbst sein Name ist umstritten. Der griechische Historiker Pachymeres, 5dem wir die Beschreibung des Sangarios-Hochwassers verdanken und der als einziger zeitgenössischer Autor Osmans Namen erwähnt, nennt ihn gar nicht Osman, sondern Ataman. Die überraschende Vorstellung, Osman habe einen anderen Namen getragen, wird von zwei späteren Quellen gestützt, einmal dem Werk eines „Lehnstuhlgeographen“, das um 1350 auf Arabisch verfasst wurde, und zum anderen einer um 1500 geschriebenen Biographie des muslimischen Heiligen Hacı Bektaş. Ataman ist ein türkischer oder vielleicht mongolischer Name, während Osman untadelig muslimisch ist, die türkische Form des arabischen ʿUthmān – wie auch der Gefährte des Propheten Mohammed hieß, der dritte Kalif des Islam. Dies hat den Verdacht geweckt, unser Osman oder Ataman könnte von Geburt Heide gewesen sein, seinen neuen Namen Osman also später angenommen haben, als er Muslim wurde. Doch wenn dies stimmen würde, wenn Osman tatsächlich ein islamischer Konvertit war, der seinen Namen änderte, warum hätten dann seine Söhne, die ohne jeden Zweifel Muslime waren, ihre echt türkischen Namen behalten sollen? 6
Читать дальше