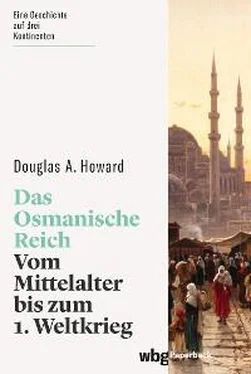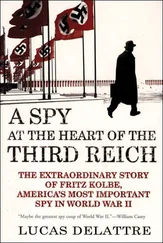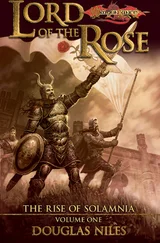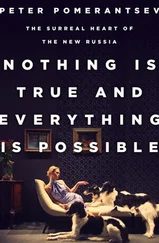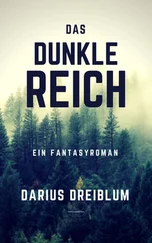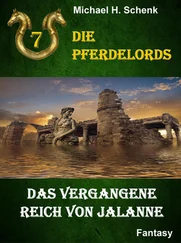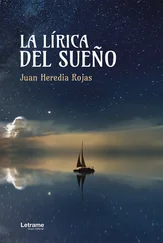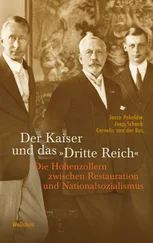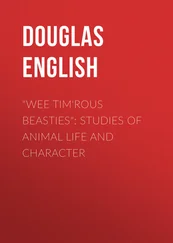Meinen Kolleginnen und Kollegen auf dem Gebiet der Turkologie und Osmanistik möchte ich für ihre überaus engagierte Arbeit und ihre Sorge um ein angemessenes Verständnis der osmanischen Geschichte danken. Wir sind ein relativ kleiner Kreis aus Gelehrten und Freunden, die einander überwiegend persönlich kennen, und stehen auf den Schultern früherer Generationen. Meine Position in den aktuellen Debatten unseres Forschungsfeldes dürfte Spezialisten unmittelbar ins Auge springen und lässt sich in den Anmerkungen nachvollziehen. Die konzeptionelle Grundlage, ohne die dieses Buch nicht hätte entstehen können, ist das Ergebnis der Arbeit von vier Giganten auf diesem Gebiet. Das eigenständige Denken von Rifa’at Ali Abou-El-Haj, für das beispielhaft sein bahnbrechender Aufsatz „The Ottoman Vezir and Paşa Households“ aus dem Jahr 1974 und sein Buch Formation of the Modern State (1992) stehen, hat einer Neukonzeption der osmanischen Geschichte jenseits der Narrative von Aufstieg und Fall erst den Weg geebnet. Victoria Holbrooks The Unreadable Shores of Love. Turkish Modernity and Mystic Romance (1994) sowie die Arbeiten von Walter Andrews – in Poetry’s Voice, Society’s Song (1985) und in den seitdem entstandenen Tagungsreferaten und gemeinschaftlichen Übersetzungen – haben die Dichtung auf überzeugende Weise ins Zentrum jeder Behandlung der osmanischen Kultur gerückt. Ariel Salzmanns hat mit ihrer Neuinterpretation des fiskalischen Modells der Osmanen in ihrer Dissertation und in dem Aufsatz „An Ancien Régime Revisited. ‚Privatization‘ and Political Economy in the Eighteenth-Century Ottoman Empire“ von 1993 die allzu simple Dichotomie von Zentralisierung oder Dezentralisierung überwunden.
Zahlreiche Beteiligte haben sich Zeit für ausführliche Gerspräche genommen. Ihre Erkenntnisse sind durch ebenso kontroverse wie freundschaftliche Diskussionen, gelegentlich hitzig, häufig aber in gelöster Atmosphäre geführt, unmerklich in dieses Buch eingeflossen. Virginia Aksan las das gesamte Manuskript gegen und steuerte wertvolle Kommentare bei. Géza Dávid las mehrere Kapitel, korrigierte viele Fehler und war stets mit gutem Rat zur Stelle. Nicht vergessen möchte ich Gábor Ágoston, Virginia Aksan, Walter Andrews, Palmira Brummett, John Curry, Linda Darling, Suraiya Faroqhi, Cornell Fleischer, Pál Fodor, Jane Hathaway, David Holt, Paul Kaldjian, Reşat Kasaba, Hasan Kayalı, Rudi Lindner, Nenad Moačanin, Victor Ostapchuk, Leslie Peirce, Amy Singer, Bill Wood, Madeline Zilfi und den leider verstorbenen Donald Quataert. Alle Fehler, die es trotz all dieser Filter noch in die gedruckte Ausgabe geschafft haben, gehen auf mein Konto.
Mehrere Kolleginnen und Kollegen haben mir freundlicherweise Materialien zukommen lassen, die mir sonst unzugänglich geblieben wären, darunter auch unveröffentlichte Aufsätze. Besonderen Dank schulde ich Virginia Aksan, Snježana Buzov, Bert de Vries, Pál Fodor, Gottfried Hagen, Tijana Krstić, Vjeran Kursar, Rudi Lindner, Nenad Moačanin, Victor Ostapchuk und Tahir Nakıp. Darüber hinaus profitierte ich von den unveröffentlichten Abschlussarbeiten mehrerer Bachelor- und Masterstudierender am Calvin College, darunter Will Clark, Spencer Cone, Lauren DeVos, Melanie Janssens, Ryan Jensen, Abby Nielsen, Emma Slager und Josh Speyers. Danke auch für die scharfsinnigen Bemerkungen von Nathan Hunt als Antwort auf eine Frage in der Abschlussprüfung.
Danke, Elisabeth und Gottfried Hagen, Carolyn und Dan Goffman, Ágota und Géza Dávid für Eure langjährige Freundschaft und Gastlichkeit. Dank auch an Telle und Gustav Bayerle für vieles, was ich gelernt habe.
Danke, Sandy, für alles.
Der berühmte türkisch-armenische Fotojournalist Ara Güler hat einmal erzählt, wie er 1958 losgeschickt wurde, um über die Einweihung eines neuen großen Staudamms am Fluss Mäander (Menderes) in der Türkei zu berichten. Er reiste aus Istanbul an, und für die dreistündige Anfahrt zu diesem Termin stellte ihm der Provinzgouverneur einen Wagen samt Fahrer zur Verfügung. Der Fototermin zog sich in die Länge. Auf der Rückreise behauptete Gülers Fahrer, er kenne eine Abkürzung durch die Berge, aber sie verirrten sich, die Sonne ging unter, und im Dunkeln konnten sie die Richtung nicht ausmachen. Als sie vor sich ein Licht sahen, hielten sie in einem Dorf an einem Kaffeehaus und fragten, ob es eine Übernachtungsmöglichkeit dort gebe. Während sich Gülers Augen an das trübe Licht im Innern gewöhnten, erkannte er in dem Kaffeehaus nicht etwa Tische, sondern sah, dass die Männer auf den Oberseiten antiker Säulen Karten spielten. 1
Am nächsten Morgen machte Güler einen Rundgang und fotografierte dabei. Das Dorf namens Geyre war vollständig inmitten der Ruinen einer antiken römischen Stadt errichtet worden. „Etwas Seltsameres habe ich nie im Leben gesehen“, erinnerte er sich später. „Die Leute sagen zwar: ‚Eine Ruine ist wie die andere‘, aber das hier war etwas völlig anderes – Vergangenheit und Gegenwart existierten übereinander.“ 2Gülers Fotos sorgten für einiges Aufsehen, als er sie zurück nach Istanbul brachte und seiner Redaktion zeigte. Eine amerikanische Zeitschrift wollte die Bilder und gab einen Artikel in Auftrag. Als Autor schlug Güler den angesehenen Archäologen Kenan Erim von der New York University vor. Im Lauf der nächsten drei Jahrzehnte besorgte Professor Erim die nötigen Geldmittel und grub die Fundstätte aus – aber erst nachdem das ganze Dorf an einen neuen, gut anderthalb Kilometer entfernten Standort verlegt worden war.
Wer heute Aphrodisias besucht, ist beeindruckt vom Ausmaß des Ruinenfelds, von den umfangreichen Überresten, die sich an einer landschaftlich ausgesprochen schönen Stelle erhalten haben, und von dem nahe gelegenen, attraktiven Museum, in dem zahlreiche Funde ausgestellt sind. Aber ohne das Dorf und nach der Verwandlung der Grabungsstätte in eine große Touristenattraktion war das „Aphrodisias des Lebens“, wie Güler es nannte, in dem die Menschen die Ruinen in ihr Alltagsleben einbezogen hatten, verschwunden. Der Ort, bemerkte er, sei jetzt Geschichte. 3
In Gülers Fotografien aus den 1950er-Jahren finden Grundzüge einer Lebenseinstellung, einer Weltsicht Ausdruck, die das Thema dieses Buches sind. Seine Bilder boten weder nostalgische Momentaufnahmen vom Landleben für ein Stadtpublikum, noch stellten sie gönnerhaft eine vermeintliche dörfliche Überzeitlichkeit einem vermeintlichen modernen Geschichtsbewusstsein gegenüber. Stattdessen zeigten die Fotos den vertrauten Umgang der Dörfler mit antiken Überresten, ihre leichtherzige Hinnahme der Natürlichkeit eines Lebens zwischen den Trümmern der Vergangenheit, die ihre alltägliche Landschaft bevölkerten. Diese Haltung steht dem Bedürfnis entgegen, Ruinen zu sammeln und auszustellen, mit Absperrungen zu umgeben und zu konservatorischen oder pädagogischen Zwecken zu musealisieren.
Aphrodisias, die antike Stadt, war in römischer Zeit ein wichtiges Zentrum des Aphroditekults und eine Kunstmetropole. Nach der Christianisierung wurde es in der Spätantike Bischofssitz. Seit etwa 1000 n. Chr. machten wandernde Turkmenenstämme Aphrodisias zum Ziel blutiger Überfälle, die Stadt entvölkerte sich langsam und wurde schließlich aufgegeben. 4Doch in den Katastern des Osmanischen Reiches ist das Dorf verzeichnet und trägt den Namen Gerye. Zwar noch nicht in den ersten Vermessungsakten der Region aus den 1460er-Jahren, 5sehr wohl aber in der Landesaufnahme von 1530 erscheint es, und dazu ein Markt. 6Irgendwann während der Jahrzehnte zwischen den beiden osmanischen Katastervermessungen ist das Ruinenfeld neu besiedelt worden. Mit seiner Lage inmitten der Ruinen war Gerye exemplarisch, aber wahrscheinlich kein Einzelfall. Die osmanische Geschichte, der Gegenstand dieses Buches, spielte sich in alten Ländern mit langer Vergangenheit ab, die an wichtige Wasserwege wie die Ägäis, das Schwarze Meer und das Mittelmeer grenzten. Überall in dieser Landschaft verstreut lagen Ruinen.
Читать дальше