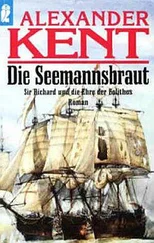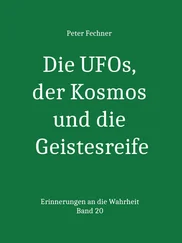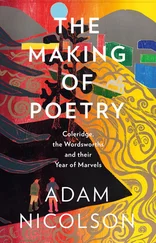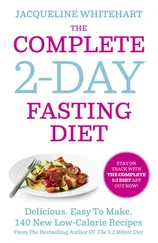1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Blanseflor og Flores Flores og Blanseflor (dän.). der siges sidst udi, at dronning Evfemia Drotning i sin time hun lod dette eventÿr rime. den ældste Edition, trÿkt i Kjöb: ved GotfredGhemen, Gotfred af (Govert van) af Gemen, 1509. haver mere end de sejermere Editioner: ja og mange steds anderledis. (nemlig om K. Marsilius, Gripon Jarl og Portneren, hvorledis de og bleve hjulpne og ophöjede)
Blanseflor og Flores Flores og Blanseflor (dän.). Dort wird am Schluss gesagt, dass „Königin EufemiaEufemia, Königin von Norwegen[,] Königin in ihrer Zeit, sie ließ diese aventiure reimen.“ Die älteste Ausgabe, gedruckt in Kopenhagen von GotfredGhemen, Gotfred af (Govert van) von Ghemen, 1509. Hat mehr als die späteren Ausgaben, ja und [ist] an manchen Stellen anders. (Nämlich über K[önig] Marsilius, Jarl Gripon und den Pförtner, wie auch sie gerettet und erhöht wurden)4
Das Phänomen des variablen Drucktextes lässt sich an Titelseiten wie jener der Flores Flores og Blanseflor (dän.)-Ausgabe 1591 besonders deutlich ablesen (Abb. 16). Hier wird die Arbeit am Text unterstrichen, wenn es – wie in der Ausgabe 1572 von Persenober og Konstantianobis Persenober oc Constantianobis (vgl. Abb. 12) – heißt, die Historia sei korrigiert worden. Obwohl auch ein Schreiber auf der Korrektheit seiner Abschrift insistieren kann, wie oben für den Ivan løveridder Ivan løveridder (dän.) festgestellt, sind Vorstellungen, dass ein Text besser, also korrekter (gemacht) worden ist, eng mit dem Druck verbunden.
Wie die Abbildungen illustrieren, weisen die einzelnen Drucke natürlich viele typographische Phänomene auf, die die frühe Buchkultur kennzeichnen, und die Flores Flores og Blanseflor (dän.)-Ausgaben zeigen denn zahlreiche Beispiele für Titelseiten, Kustoden, Kolumnentitel, Bogennumerierungen, später Paginierungen, Kolophone usw. Die Drucke 1605–1745 enthalten daneben Holzschnitte und Titelkupfer und anderen Schmuck, oft nach deutschem Vorbild. An ihnen lässt sich die Transmissionsgeschichte dieser mittelalterlichen Erzählung im 17. und 18. Jahrhundert ausgezeichnet nachvollziehen (vgl. Abb. 20–28).
Die erste vollständig erhaltene Flores Flores og Blanseflor (dän.)-Ausgabe 1509 setzt mit folgendem Incipit ein: „Hær begyndes en historie aff Flores oc Blantzeflor“ (Hier beginnt eine Historie von Flores und Blanzeflor) (vgl. Abb. 14).5 In der nächsten erhaltenen Ausgabe 1591 ist das Incipit dann ersetzt durch eine eigentliche Titelseite, wie sie in der Folge in sämtlichen Drucken verwendet wird (Abb. 16): „En Lystelig oc skøn Historia paa Rim / Om Blantzeflor oc Flores / Oc er nu paa nyt for=bedret oc rettere offuer seet end hun vor førre. 1591.“ (Eine lustige und schöne Historia in Reimen, über Blantzeflor und Flores, Und ist nun aufs Neue verbessert und richtiger durchgesehen als sie zuvor war. 1591.)
Ein solcher Titel erlaubt es, mehr Information zu vermitteln. So wird hier der Begriff ,Historia‘ durch „lystelig“ bzw. in anderen Ausgaben „lystig“ und „skøn“ amplifiziert (vgl. auch Persenober Persenober oc Constantianobis 1572, Abb. 12). Zudem verweist der Titel wie erwähnt darauf hin, dass der Text korrigiert und (erneut) verbessert worden sei, eine Information, die sich in allen folgenden Ausgaben 1605, 1695, 1745 hält (vgl. Abb. 20, 23, 26). Diese toposhafte, in unzähligen Drucken verwendete Formel ist im Zusammenhang mit dem oben angesprochenen Konzept zu sehen, entsprechend dem es eine richtige Form eines Textes gibt, die es durch Verbesserungen und Durchsicht bestehender Texte herzustellen gilt, wo diese von der korrekten Form abweichen. An solchen Titeln lässt sich die Entstehung einer frühneuzeitlichen Textkritik sehr schön beobachten.
Anhand der Kolophone der frühneuzeitlichen Flores Flores og Blanseflor (dän.)-Ausgaben 1509 bis 1745 kann als weiteres spezifisches Phänomen die Entwicklung der medialitätsbezogenen Aussagen in diesen Paratexten summarisch nachgezeichnet werden. Die Änderungen, die die verschiedenen Drucke vornehmen, reagieren dabei recht konkret auf die technologischen Innovationen, die der Buchdruck mit sich brachte. Das Kolophon der ältesten vollständig erhaltenen Druckausgabe von 1509 (vgl. Abb. 15) führt noch die spätmittelalterliche Tradition weitgehend fort, wie sie durch die Epiloge in K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket) vertreten ist:
Nv haffuer thet awentyr endhe
gudh han oss sijn naade sende
Eufemia drotning i sijn tijme
hvn lod thettæ æwentyr skrijffue
Gut giffue them naade bogen giorde
oc saa alle henne hørde
Goth leffnet oc reth skrifte maal
oc til hemmerige at komme wor syel
Tijl ihesu cristi signede hende
oc ther at blifue for vden ændhe ( Flores oc Blantzeflor 1509: [gviij r–v])
Nun hat die Erzählung ein Ende, Gott uns seine Gnade sende. Königin Eufemia zu ihrer Zeit, sie ließ diese Erzählung schreiben. Gott gebe denen Gnade, die das Buch machten, und so allen denen, die es hörten. Gutes Leben und gerechte Beichte und dass ins Himmelreich komme unsere Seele. Bis Jesus Christus sie segne und [sie] dort bleibe ohne Ende.
Auch wenn bereits gewisse Kürzungen im Verhältnis zu K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket) festzustellen sind, sind doch mit der königlichen Mäzenin, dem Dichter/Übersetzer und den Zuhörern die wesentlichen Beteiligten an der Herstellung der Handschrift und der Anwesenden am Vortrag erwähnt.
1591 (vgl. Abb. 18) hat gegenüber 1509 natürlich Änderungen orthographischer und typographischer Art. Hier wird zudem das Reimwort zu „time“ – 1509: „skrijffue“ – in das besser passende „Rime“ geändert und die Tätigkeit der anwesenden Zuhörenden in 1509 mit dem allgemeineren „fremme oc forde“ umschrieben. Zudem erwähnt dieses Kolophon von 1591 explizit „Christelig tro“:
Nu haffuer dette euentyr ende
Gud han oss sin naade sende
Eufemia Drotning i sin time
hun lod dette euentyr Rime
Gud giffue dem naade bogen giorde
oc alle som hende fremme oc forde
Gud giffue oss alle en Christelig tro
oc euindelig i Himmerige bo
Til Jesu Christi signede hende
oc der at bliffue for wden ende. ( Historia om Blantzeflor oc Flores 1591: 31 [vgl. Abb. 18])
Nun hat diese Erzählung ein Ende, Gott uns seine Gnade sende. Königin Eufemia zu ihrer Zeit, sie ließ diese Erzählung reimen. Gott gebe denen Gnade, die das Buch machten, und so allen denen, die es beförderten und führten. Gott gebe uns allen einen christlichen Glauben und dass wir ewig im Himmelreich wohnen. Bis Jesus Christus sie segne und [sie] dort bleibe ohne Ende.
Die Ausgabe 1591 enthält nach dem Ende der Erzählung zudem einen interessanten Zusatz, den der Herausgeber Jørgen Olrik als „Efterskrift“ (Nachschrift) bezeichnete (vgl. Abb. 18–19). Es handelt sich um einen rund zweiseitigen Bogenfüller, der den neu angenommenen protestantischen Glauben preist und auf den ersten Blick kaum etwas mit der ,Geschichte an sich‘ zu tun hat. Die Nachschrift formuliert aus protestantischer Perspektive eine Kritik am alten Glauben, der im Zentrum von Flores og Blanseflor Flores og Blanseflor (dän.) steht:
NAar Christne Menniske lesæ / eller høre saadant som er emod Gud oc vor Christelige tro / Da skulle de Tacke oc Loffue Gud Almectigste / som aff sin egen godhed oc store miskundhed for wden alt fortieniste skyld / haffuer dragit dem aff saadan vildfarelse oc store forblindelse nu i disse sidste dage / Oc vnt dem at de nu maa høre oc lære hans egne klare oc rene Ord oc Euangelium / Oc vide oc forstaande / at de skulle icke søge effter deris salighed til S. Jacobs / eller i Closter som de giorde. Icke skulle wi heller dømme dem / fordi at de saa giorde / Thi Gud kende sine wduolde aff euig tid / Han kunde oc da saa vel som nu gøre dem salige / Oc giffue dem der den rætte tro i deris hierte paa deris yderste time. Haffde de paa den tid / hørt Guds klare oc rene Ord som wi nu gøre / da Haffde de for wden tuiffuel verit fast bedre Christne end wi ære oc icke søgt effter deris salighed wdi saadane Dieffuelens bedragelser oc vildfarelser […] ( Historia om Blantzeflor oc Flores 1591: [Dvvi v–Dvvi r])
Читать дальше