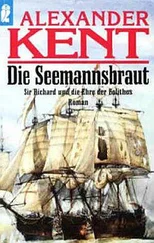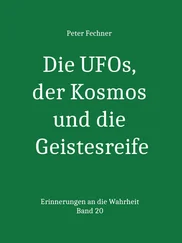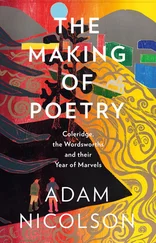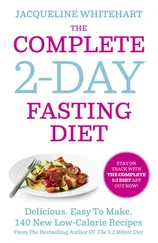Wenn christliche Menschen lesen oder hören, was gegen Gott und unseren christlichen Glauben ist, dann sollen sie Gott dem Allmächtigen danken und ihn loben, der nun in diesen letzten Tagen aus seiner eigenen Güte und großen Gnade heraus und ohne jegliches Verdienst solche Täuschung und Verblendung von ihnen genommen hat, und ihnen gegönnt hat, dass sie nun seine eigenen klaren und reinen Worte und sein Evangelium hören und lernen können, und wissen und verstehen [können], dass sie für ihre Seligkeit nicht bei St. Jakob oder im Kloster suchen sollen, wie jene es taten. Aber wir sollen sie auch nicht verurteilen, dass sie so handelten, denn Gott kennt seine Auserwählten von ewiger Zeit. Er könnte sie damals wie auch jetzt selig machen und ihnen in ihrer letzten Stunde den rechten Glauben in ihr Herz geben. Hätten sie zu ihrer Zeit Gottes klare und reine Worte gehört, wie wir es nun tun, dann wären sie ohne Zweifel sicher bessere Christen gewesen, als wir es sind, und hätten ihre Seligkeit nicht in solchen Betrügereien und Täuschungen des Teufels gesucht.
Der Text dieser Nachschrift von 1591 (die vermutlich bereits in der verlorenen Ausgabe von 1542 vorhanden war, wofür die Passage „nun in diesen letzten Tagen“ spricht) fügt sich damit in die für das sechzehnte Jahrhundert typische Reformationspropaganda ein, stellt jedoch zugleich einen direkten Bezug zum Moniage her, die Blanseflor und Flores Flores og Blanseflor (dän.) am Ende ihrer Geschichte in der katholischen Zeit vollziehen.6 Dadurch wird deutlich, dass die scheinbar isolierte und beziehungslose Nachschrift eben doch eine ganz klare Stellungnahme zur Textaussage vornimmt und ein erstrangiges Rezeptionsdokument darstellt. Auch Drucke haben die Möglichkeit, Narrative zu kontextualisieren.
Mit Ausnahme der Nachschrift, die nur in 1591 enthalten ist, hat die nächste Ausgabe 1605 (vgl. Abb. 22) gegenüber 1591 kaum Änderungen und auch 1695 und 1745 (vgl. Abb. 25, 28) sind mit 1605 fast identisch. Das Kolophon umfasst in allen Ausgaben 1509–1745 zehn Zeilen. Die Zuschreibung an Königin EufemiaEufemia, Königin von Norwegen, einer der festen Bestandteile seit der Niederschrift der altschwedischen Eufemiavisor Eufemiavisor (schwed.), und die Einbeziehung von Dichter und Zuhörenden in das abschließende Gebet werden ebenfalls bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts formelhaft überliefert. So tragen die Kolophone wesentlich dazu bei, die literarische Erinnerung an die mittelalterliche Mäzenin und die medialen Konstellationen bis zum Beginn der Moderne zu bewahren.
Jørgen Olrik beurteilte in der Einleitung zu seiner Flores Flores og Blanseflor (dän.)-Ausgabe in Band 6 der Danske Folkebøger von 1925 die jüngeren Fassungen wenig gnädig:
I Renaissancetiden er Digtningen blevet underkastet en grundig Omarbejdelse, hvorved det er lykkedes at fjærne de fleste Spor af middelalderlig Poesi og erstatte dem med trivielle Rimerier. Herhen hører de yngre Udgaver af 1605, 1684 og 1695 […]. (Jacobsen/Olrik/Paulli, 6, 1925: XXVI)
In der Renaissancezeit wurde das Gedicht einer gründlichen Überarbeitung unterworfen, wodurch es gelang, die meisten Spuren von mittelalterlicher Poesie zu entfernen und sie mit trivialen Reimereien zu ersetzen. Hierzu gehören die jüngeren Ausgaben von 1605, 1684 und 1695 […].
R. Paullis Urteil fiel fast wortwörtlich gleichlautend aus, als er 1936 im Schlussband von Danske Folkebøger schrieb, es handle sich bei den nachmittelalterlichen Bearbeitungen von Flores og Blanseflor Flores og Blanseflor (dän.) um „en bevidst Omarbejdelse […] har klemt Poesien ud af Livet paa Flores og Blanseflor og gjort den til et trivielt Rimeri“ (Paulli 1936: 237) (eine bewusste Überarbeitung […] hat die Poesie aus Flores und Blanseflor vertrieben und sie [die Geschichte] zu einer trivialen Reimerei gemacht). Olriks Äußerungen zu den Drucken von Persenober Persenober oc Constantianobis und Laurin Dværgekongen Laurin sind ähnlich negativ und man kann in ihnen nicht nur ablesen, dass die Herausgeber wenig Sympathie für die Texte hatten, mit denen sie sich beschäftigten. Wichtiger ist, dass aus ihnen eine zeittypische Polemik gegen Textveränderungen spricht, in denen man lediglich ein vermeintliches Sinken von Kulturgut erkennen konnte. Dass die Rede von der Trivialisierung längst obsolet geworden ist, braucht nicht eigens hervorgehoben zu werden. Eine vorurteilsfreie Analyse des spätmittelalterlichen / frühneuzeitlichen Transmissionsprozesses vermag aufzuzeigen, welch aufschlussreiche Einblicke in die Textualität, Medialität, Transgression diese handschriftlich und gedruckt überlieferten Texte bieten.
IV Dänische Ritterdichtung um 1500 und um 1750
Die drei in der Handschrift K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket) überlieferten dänischen Eufemiaviser Eufemiaviser (dän.) Ivan løveridder Ivan løveridder (dän.) , Hertug Frederik af Normandi Hertug Frederik af Normandi (dän.) und Flores og Blanseflor Flores og Blanseflor (dän.) stellen wichtige Rezeptionsdokumente aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert dar. Sie belegen die spätmittelalterliche Transmission der im hohen Mittelalter verfassten schwedischen Eufemiavisor Eufemiavisor (schwed.) und sind die wichtigsten Repräsentanten der höfisch-ritterlichen Literatur in Dänemark am Übergang zur Frühneuzeit. Durch ihre spezifische Anordnung in der Handschrift K 47, die von jenen in den Handschriften der schwedischen Eufemiavisor abweicht, und die zahlreichen intertextuellen Beziehungen zu den anderen Erzählungen in K 47 erhalten die drei dänischen Eufemiaviser eine besondere Aussagekraft. Am Beispiel der rasch einsetzenden nachmittelalterlichen Überlieferung von Flores og Blanseflor lässt sich zudem zeigen, wie das Genre der Eufemiaviser einen Medienwechsel zum Buchdruck vollzog, was es ihm erlaubte, eine weitere Etappe in einer zeittiefen Transmission zu nehmen und dadurch wesentliche Aspekte der höfischen Literatur in die literarischen Diskurse der Neuzeit zu überliefern.
Andersson, Roger (2014). „Die Eufemiavisor – Literatur für die Oberklasse“. In: Glauser, Jürg/Kramarz-Bein, Susanne (Hg.). Rittersagas. Übersetzung, Überlieferung, Transmission (= Beiträge zur Nordischen Philologie 45). Tübingen: Francke, S. 45–69.
Bambeck, Florian (2009). Herzog Friedrich von der Normandie. Der altschwedische Ritterroman „Hertig Fredrik av Normandie“. Text, Übersetzung, Untersuchungen. Wiesbaden: Reichert.
Bandlien, Bjørn (Hg.) (2012). Eufemia – Oslos middelalderdronning . Oslo: Dreyers Forlag.
Bandlien, Bjørn/Eriksen, Stefka G./Rikhardsdottir, Sif (Hg.) (2015). „Arthur of the North: Histories, Emotions, and Imaginations“. In: Scandinavian Studies 87:1, S. 1–166.
Blaisdell, Foster W. (Hg.) (1979). Ívens saga (= Editiones Arnamagnæanæ, B, 18). Copenhagen: Reitzel.
Boberg, Inger M. (1966). Motif-Index of Early Icelandic Literature (= Bibliotheca Arnamagnæana 27). Copenhagen: Munksgaard.
Brandt, C. J. (Hg.) (1869–1870). Romantisk Digtning fra Middelalderen . I–II. København: Samfundet til den danske Literaturs Fremme.
Dahlberg, Torsten (1950). Zum dänischen Lavrin und niederdeutschen Lorin. Mit einem Neudruck des einzig erhaltenen niederdeutschen Exemplars (Hamburg um 1560) (= Lunds universitets årsskrift N. F., Avd. 1, 45:5; Lunder germanistische Forschungen 21). Lund: C. W. K. Gleerup.
Dahlerup, Pil (1998). „Ridderroman“. In: Dansk litteratur. Middelalder. 2. Verdslig litteratur . København: Gyldendal, S. 235–274.
Читать дальше