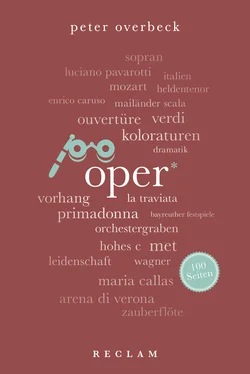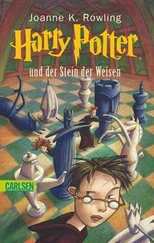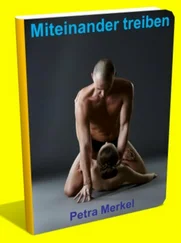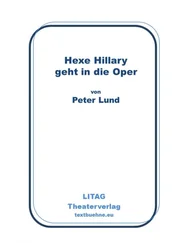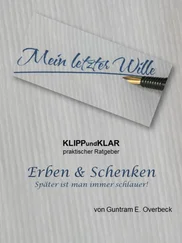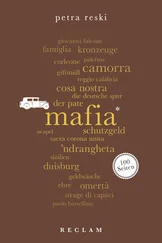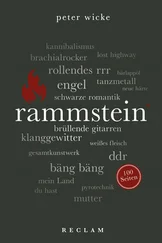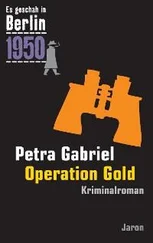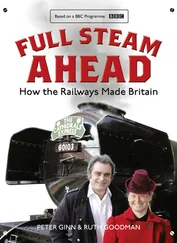In den sogenannten »Nummernopern« werden die einzelnen geschlossenen Musikstücke – Ouvertüre, Rezitative und Arien, Ensembles, Chöre, Ballette, Instrumentalzwischenspiele – im wahrsten Sinne des Wortes durchnummeriert und folgen stereotyp aufeinander. Eine Entwicklung des 18. Jahrhunderts ist es, einzelne Nummern zu größeren Szenen zusammenzufassen; das kündigt sich auch schon im Spätbarock an, ausgeprägt ist es bei Mozart, zum Beispiel im Finale des 2. Aktes von Le Nozze di Figaro . Die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt eine Tendenz zur durchkomponierten Oper. Besonders Richard Wagner suchte quasi ein musikalisches Äquivalent zur Vortragsweise von Sprechtexten. Das Extrem ist dann ein Kontinuum von fast zwei Stunden wie im Falle von Richard Strauss’ Salome (1905) oder Elektra (1909) mit integriertem Instrumentalvorspiel. Hier muss der Opernbesucher sogar auf die gewohnte Pause verzichten.
Monteverdi, Händel, Gluck, Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Wagner, Puccini, Strauss. Die Opern dieser Komponisten prägen zum einen das Repertoire, zum anderen sind sie stilprägend für Epochen und für die nachfolgenden Komponistengenerationen.
Die Entstehung der Oper als Ausgangspunkt einer der zentralen Gattungen der europäischen Musikgeschichte ist eigentlich auf ein Missverständnis aus der Zeit der Renaissance zurückzuführen. Die Mitglieder der »Florentiner Camerata« – einer Vereinigung von Adligen, Gelehrten und ausübenden Musikern am Hof der Medici, versuchten um 1580, die griechische Tragödie wiederzubeleben; sie waren der Ansicht, dass bei ihr der Gesang eine zentrale Rolle spielte, doch niemand wusste, wie das geklungen haben könnte. Deswegen unternahm man das Experiment, die Texte so zu singen und instrumental zu begleiten, dass ihre Aussage gut verständlich bleibt. Text vor Musik gewissermaßen. Für diese Art des Vortrags zwischen Singen und Sprechen wurde der Begriff »recitar cantando«, also »singend deklamieren«, verwendet, für die Form der Begriff »Dramma per Musica«. So entstanden in Florenz die ersten Werke: Jacopo Peris Dafne (1598, Musik verschollen) und Euridice (1600) sowie Euridice (1602) von Giulio Caccini.
Für die nachhaltig wirksame Umsetzung solcher Ideen bedurfte es jedoch eines musikalischen Genies wie Claudio Monteverdi (1567–1643). Im seinerzeit fortgeschrittenen Alter von 40 Jahren komponierte er für Mantua, wo er seit 1601 am Hofe der Gonzaga als musikalischer Kapellmeister tätig war, zu einem Libretto von Alessandro Striggio sein erstes musiktheatralisches Werk. L’Orfeo (1607) erzählt den bekannten Mythos um den Sänger Orpheus, der durch seine Kunst bei den Göttern der Unterwelt die Rückgabe seiner verstorbenen Gattin Eurydike zu erwirken sucht. Musikalisch charakterisiert Monteverdi in diesem Werk die Figuren mit den Klangfarben von 33 verschiedenen Instrumenten.
Die Monodie, also der Sologesang mit Generalbassbegleitung, war ein Bruch mit der Polyphonie der Renaissance (in der Begrifflichkeit von Monteverdi: Prima pratica) und wurde – quasi auf den Punkt genau zum Wechsel des Jahrhunderts – der Beginn einer neuen Form des musikalischen Erzählens. Diese Seconda pratica räumte dem Ausdruck des Textes Vorrang vor dem Tonsatz ein und ermöglichte zudem satztechnische Freiheiten gegenüber bisher gültigen Regeln, etwa bei der Behandlung von Dissonanzen.
Monteverdi war zwar bei seinen Zeitgenossen berühmt, geriet dann aber rasch in Vergessenheit. Seine Werke mussten Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt werden. Heute ist er gewissermaßen bei jeder Übertragung eines Musikereignisses durch die EBU (Europäische Rundfunkunion) präsent, denn die zu Beginn eingespielte Euroradio-Fanfare ist die eröffnende Toccata des Orfeo .
Daten der Operngeschichte im Überblick
( UA= Uraufführung)
1598 UAJacopo Peri: Dafne in Florenz (Palazzo Corsi)
1607 UAClaudio Monteverdi: L’Orfeo in Mantua (herzoglicher Palast)
1637 Eröffnung des Teatro San Cassiano in Venedig, des ersten öffentlichen Opernhauses
1643 UAClaudio Monteverdi: L’incoronazione di Poppea in Venedig (Teatro Santi Giovanni e Paolo)
1678 Eröffnung der Hamburger Oper am Gänsemarkt, des ersten öffentlichen Opernhauses auf deutschem Boden
1684 (?) UAHenry Purcell: Dido and Aeneas in London
1711 UAGeorg Friedrich Händel: Rinaldo am Londoner Haymarket (Queen’s Theatre)
1733 UAGiovanni Battista Pergolesi: La serva padrona in Neapel (Teatro San Bartolomeo – 1752 in Paris Auslöser für den Buffonisten-Streit
1786 UAWolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di Figaro in Wien (Burgtheater)
1787 UAWolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni in Prag (Nationaltheater)
1805 UALudwig van Beethoven: Fidelio in Wien (Theater an der Wien)
1821 UACarl Maria von Weber: Der Freischütz in Berlin (Schauspielhaus)
1826 UACarl Maria von Weber: Oberon in London (Covent Garden)
1829 UAGioacchino Rossini: Guillaume Tell in Paris (Académie Royale de Musique)
1830 Eine Aufführung von Daniel-François-Esprit Aubers La Muette de Portici in der Brüsseler Oper ist Auslöser für die belgische Revolution
1842 UAGiuseppe Verdi: Nabucco in Mailand (Teatro alla Scala)
1850 UARichard Wagner: Lohengrin in Weimar (Hoftheater)
1876 UAvon Richard Wagners komplettem Ring des Nibelungen in Bayreuth (neuerbautes Festspielhaus)
1882 UARichard Wagner: Parsifal in Bayreuth (Festspielhaus)
1893 UAGiuseppe Verdi: Falstaff in Mailand (Teatro alla Scala)
1900 UAGiacomo Puccini: Tosca in Rom (Teatro Costanzi)
1902 UAClaude Debussy: Pelléas et Mélisande in Paris (Salle Favart)
1905 UARichard Strauss: Salome in Dresden (Semperoper)
1911 UARichard Strauss: Der Rosenkavalier in Dresden (Königliches Opernhaus)
1925 UAAlban Berg: Wozzeck in Berlin (Staatsoper)
1926 UAGiacomo Puccini: Turandot in Mailand (Teatro alla Scala), unvollendete Version durch Toscanini
1937 UAAlban Berg: Lulu (Akte 1 and 2) in Zürich (Stadttheater), 1979 UAder dreiaktigen Version, vervollständigt von Friedrich Cerha in Paris (Opéra Garnier)
1951 UAIgor Strawinsky: The Rake’s Progress in Venedig (La Fenice)
1957 UAArnold Schönberg: Moses und Aron in Zürich (Opernhaus, posthum, konzertant bereits 1954 in Hamburg [NWDR])
1965 UABernd Alois Zimmermann: Die Soldaten in Köln (Oper Köln)
1992 UAWolfgang Rihm: Die Eroberung von Mexiko in Hamburg (Staatsoper)
1997 UAHelmut Lachenmann: Das Mädchen mit den Schwefelhölzern in Hamburg (Staatsoper)
2002 Karlheinz Stockhausen vollendet den 1977 begonnenen siebenteiligen Opernzyklus Licht

Zweiter Akt »Prima la musica, poi le parole« (Salieri): Vom Stoff zur Oper
Zentral für das Gesamtkunstwerk Oper ist neben der Musik natürlich der Text. »Es ist eine Menge von Worten und geht gelegentlich bei Reclam zu kaufen«, so Peter Hacks’ etwas eigenwillige Definition für »Libretto«. Konkreter heißt es im Riemann Musiklexikon : »Libretto, Italienisch das kleinformatige Textbuch und der Text selbst zu musikalisch-szenischen Werken, besonders zu Opern, Operetten, Singspielen und Musicals.« (Bd. 3. S. 201)
Читать дальше