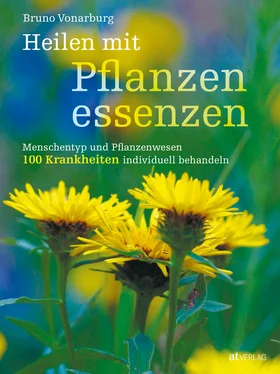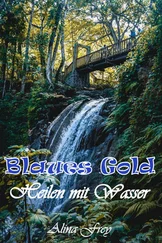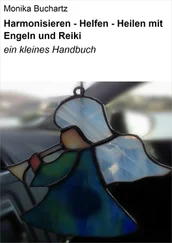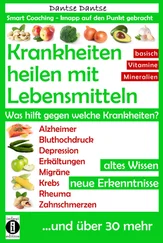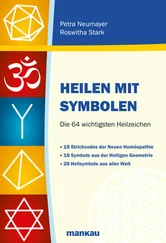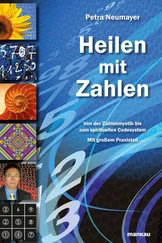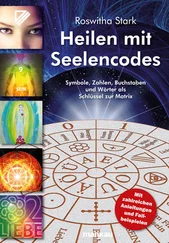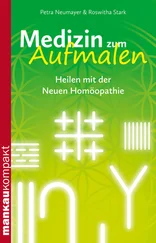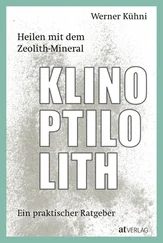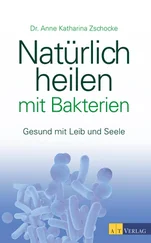Prof. Alfred Popp gelang es 1975, die Lichtquanten der Strahlung lebender Zellen wissenschaftlich nachzuweisen. Er nannte sie »Biophotonen«. Diese haben auch bei der Entstehung von kanzerogenen Erkrankungen eine große Bedeutung. Gesunde wie auch kanzerogene Zellen besitzen ein Strahlungsvermögen. Bei einer Krebserkrankung ist nach Prof. Popp jedoch die Kommunikation des organischen Zellsystems gestört, das nur durch eine kohärente, geordnet ausgerichtete Strahlung gewährleistet ist. Im Falle einer inkohärenten Strahlung besteht eine Irritation des Informationsaustauschs unter den Zellverbänden. Dies kann zur krankhaften Zellmutation führen. Die Aufgabe der Wissenschaft für die Zukunft wird sein, sogenannte Biophotonen-Scanner zu entwickeln, um krankhafte Zellstrahlungen nachweisen zu können. Allein an der Tohoku-Universität in Japan wurden in den letzten fünf Jahren über hundert Millionen Euro für die Biophotonenforschung eingesetzt, und man darf gespannt sein, welche bahnbrechenden Entdeckungen uns dereinst präsentiert werden. Bei der konstitutionellen Phytotherapie allerdings machen wir uns heute schon die Schwingungsmuster der Arzneipflanzen zunutze.
Dynamik der Pflanzenarznei und des Menschen
Durch die Trituration wird die Arzneipflanze in ihrem stofflichen und feinstofflichen Kern aufgerieben, wachgerüttelt und dynamisiert. Mittels der sonnenimprägnierten Energie der Blüte wird deren Schwingungsmuster aufgefangen, gespeichert und vom Patienten mit aufgenommen. Das Besondere an dieser Arzneiform ist eine Eigenschaft, die allen Energieformen eigen ist: zu kommunizieren, in Resonanz zu treten, zu schwingen. Vergleichbar dem Anschlagen einer Taste auf dem Klavier, bei dem nicht nur der angeschlagene Ton, sondern auch alle Ober- und Untertöne mit hörbar werden.
Pflanzen und Menschen sind Energieträger, die Signale aussenden und empfangen können. In diesem Sinne können die Trifloris-Essenzen als kleine Homöopathie der Phytotherapie verstanden werden. So gilt auch das Simile-Gesetz: »Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt.« Nur die Arznei, die wie ein Schlüssel ins Schloss des individuellen Krankheitsbildes eines Menschen passt, wird zur Therapie eingesetzt.
All diese Betrachtungen führen zu verfeinerten, tiefgründigeren Pflanzen-Monografien. Traditionell bekannte Aspekte und neueste Erkenntnisse werden dabei zu einem umfassenden Gesamtgefüge vereinigt, was bei den im Buch beschriebenen Hauptmitteln immer neu aufgezeigt und im Folgenden am Beispiel des Schachtelhalms und des Lavendels ausführlich dargestellt wird. Mittels der neuartigen Betrachtungsweise finden wir Indikationen für Arzneipflanzen, die in keinem Lehrbuch stehen.
SCHACHTELHALM (EQUISETUM ARVENSE L.)
Als ein geradezu perfektes Beispiel offenbart sich der Schachtelhalm, der auf der ganzen nördlichen Erdhalbkugel verbreitet ist. Bei der Familie der Schachtelhalmgewächse (Equisetopsida) handelt es sich um ein Relikt aus schwindelerregender Vergangenheit vor über 400 Millionen Jahren. Schachtelhalme sind die letzten Überlebenden eines riesigen Pflanzenreichs, das am Ende der Urzeit einem immensen Massensterben anheimgefallen ist. Heute sind nur noch 32 Arten übrig. Die große Krise spielte sich in einer extremen Trockenperiode ab: Bis zu 30 Meter hohe Schachtelhalmbäume gediehen damals auf sumpfigen Steinkohlewäldern, und unter ihnen tummelten sich gewaltige Tiergiganten, die Saurier. Reste der Schachtelhalm-Riesen schieben wir heute im Winter als Steinkohle in die Öfen, und jedes Stück erzählt uns eine unfassbare Geschichte.
Wie der Bärlapp und der Farn gehört der Schachtelhalm zu den sogenannten Gefäß-Kryptogamen, die zwar Wurzeln, vereinzelt sogar primitive Blüten, aber keine Samen produzieren. Stattdessen entwickeln sie im Frühjahr chlorophyllfreie Sporen. Sie enthalten sogenannte Vorkeime (Prothallien), deren weibliche und männliche Gameten sich gegenseitig befruchten und neue Generationen schaffen. Die Schilder der Sporangienträger zeigen unter dem Mikroskop eine konstruierte, sechseckige Form – geometrisch vollendet wie eine Bienenwabe.
Die Aufbaustoffe der Sporentriebe werden im unterirdischen Spross produziert. An ihnen befinden sich kleine Knollen (wie bei der Kartoffel) als Vorratsbehälter, die tief in der Erde verborgen liegen. Nach der Sporenreife sterben die oberirdischen Frühjahrstriebe, die braunen, walzenförmigen Gebilde, ab. Es erscheinen die Sommersprosse, die wie kleine Tannenbäumchen aussehen und sowohl Chlorophyll als auch eine große Menge an Kieselsäure enthalten.
Zu Heilzwecken werden nur die fadenartigen, kantigen Blätter des Sommertriebs verwendet. Beim Einsammeln muss darauf geachtet werden, dass nur der Echte Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense L.) mit dünnem Stängel und grünen Manschetten an den Knoten (Nodien) gepflückt wird. Als Erkennungsmerkmal dienen die untersten Glieder der Seitenäste (Blätter), die länger als die zugehörigen Scheiden sind.
Andere Arten wie der Wald-, Sumpf-, Riesen- oder Wiesenschachtelhalm beherbergen einen schmarotzenden, schwarzfarbigen Pilz (Ustilago equiseti), der das Alkaloid Equisetin produziert. Nach dem Verzehr verursacht es toxische Symptome wie Brechreiz, Erbrechen und Unwohlsein. Wird eine Schachtelhalmpflanze auf Platinmetall verglüht, bleibt nach der Verkohlung ein glasartiges Skelett von Silizium zurück. Rund 10 Prozent dieses Silikats sind wasserlöslich.
Gesundheitsfördernde Kieselsäure
In der Phytotherapie hat die Kieselsäure des Schachtelhalms eine wichtige Bedeutung. Bereits 1878 schilderte Louis Pasteur: »Die therapeutische Wirkung des Siliziums wird in der Zukunft noch eine große Rolle spielen.« Mittlerweile ist bekannt, dass Silikate, wie sie auch in Hafer und Gerste vorkommen, für die Gesundheit des Menschen unentbehrlich sind. Sie zählen zu den zwölf wichtigsten Mineralien unseres Organismus. Normalerweise wird der Bedarf durch eine ausgewogene Ernährung gedeckt. Die moderne Zivilisationskost mit ihren Denaturierungsprozessen fördert jedoch nachweisbar Mangelzustände. Die Substitution durch kieselsäurehaltige Pflanzen wie den Schachtelhalm unterstützt vor allem die Stärkung des Bindegewebes und ist hilfreich für Knochen, Haut, Bänder, Sehnen, Haare und Nägel sowie die Widerstandskraft der Haut.
Das Bindegewebe ist Konsole, Stütze, Pfeiler und Gestell unseres Organismus. Es sorgt dafür, dass die Organe in ihrem Verbund nicht auseinanderfallen. Hierzu benötigt unser Gewebe, das aus weitmaschigen Zellverbänden besteht, substanzielle wie auch feinstoffliche Aufbaustoffe – insbesondere Silizium.
Phytotherapeutisch dient der Schachtelhalm mit seinem Kieselsäuregehalt zur Straffung des Bindegewebes und zur Härtung der Wirbelkörper. Somit ist er sehr hilfreich bei Bandscheibenschäden, Wirbelsäulendeformierungen während des Wachstums, bei Elastizitätsmangel von Bändern, Sehnen und Haut, Gewebsschwäche von Gefäßen (Arterien, Krampfadern, Hämorrhoiden), Kapillarbrüchigkeit (Couperose), Veranlagung zu Aneurismen, Schwangerschaftsstreifen, Zellulitis, Blasensenkung, Gebärmuttervorfall, Analprolaps, Beckenbodenschwäche, Neigung zu Hernien, Abnutzungserscheinungen von Knochen und Gelenken (Arthrose, Spondylose), Osteoporose, bei brüchigen Fingernägeln, Hausausfall, Parodontose und zur Festigung des Lungengewebes.
Psychodynamische Wirkung
Der Schachtelhalm bewirkt auch eine Stabilisierung der Psyche. Er fördert die innere Harmonisierung, Flexibilität und die Resilienz. Er stützt und festigt, macht elastisch, flexibel, widerstandsfähig und standhaft. In ihrer Wesensart repräsentiert die Pflanze Struktur, Gliederung, Lagerung, Schichtung und Verdichtung. Alle diese Eigenschaften können als Signatur verstanden werden. Sie eignen sich für Menschen mit Leistungsknick und einer Hinfälligkeit der inneren Ordnung. Ebenso für solche, die eine klare Lebensstruktur und das psychische Standvermögen verloren haben.
Читать дальше