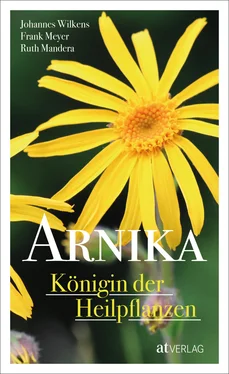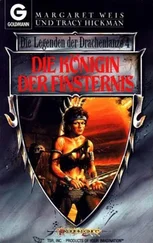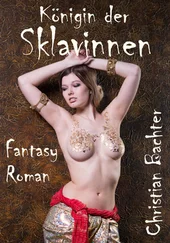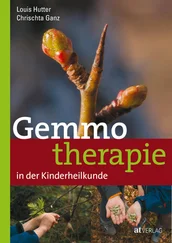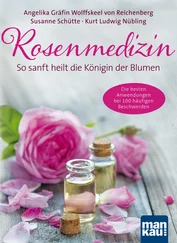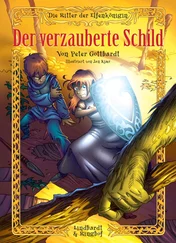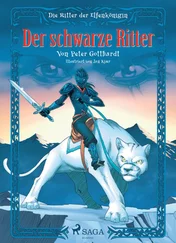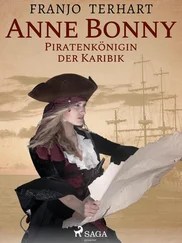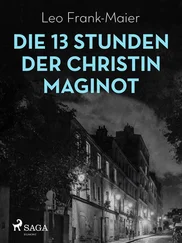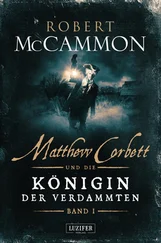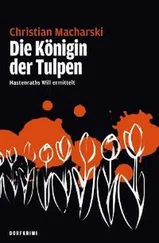Ebenso ist die »wirbelige« Dynamik der Zungenblüten, ihre Unregelmäßigkeit, ein Zeichen von Plastizität und überbordender Lebendigkeit, die hier über die Formkraft siegt, die sonst im Blütenbereich vorherrscht. Wenn Goethe die Arnika im Vogtland »herrschend« nennt, dann meinte er wahrscheinlich ihre Fähigkeit, sich in einer ihr gemäßen Landschaft wirklich flächendeckend auszubreiten. Dazu verhilft ihr das vitale Rhizom. »Wüthend« beschreibt jedoch eine andere Ebene. Nahm der geniale Pflanzenkenner dabei womöglich die geballte, aber gebändigte Vitalität wahr – dieselbe, welche die Arnika mit dem Wolf verbindet?
Torsten Arncken und Ulrike Ortin unternahmen 1994 eine Forschungsreise in die USA, um einige amerikanische Arnikaarten zu studieren. Anschließend bauten sie in Dornach/Schweiz vier dieser Arten an, um sie mit Arnica montana zu vergleichen. In ihrem Abschlussbericht charakterisieren sie die nordamerikanischen Arten folgendermaßen: »Die vier von uns angebauten Arnika-Arten sind alle deutlich wüchsiger als Arnica montana . Sie bilden im zweiten Jahr schnellwüchsige Ausläufer, die noch im selben Jahr zur Blüte kommen und dichte Horste bilden. (…) Die nordamerikanischen Arten bilden kein verdicktes Rhizom und kaum Geschmack oder Geruch in der Wurzel« (ARNCKEN und ORTIN 1996, S. 42 und 46). Sie beschreiben, dass der Blattbereich stärker betont wird als die Blütenregion, die Blätter also zahlreicher sind und am Stängel weit mit hinaufgenommen werden. Die Blätter sind nicht so zäh und ledrig wie bei Arnica montana, sie duften sehr stark und sind klebrig-ölig. Die Stängel sind weitaus dünner und zarter, und es werden mehr Seitentriebe gebildet. Die Blüten sind kleiner als die von Arnica montana, und sie duften kaum.
Dies alles bestätigt, dass bei den anderen Arnikas die vegetative, blättrige Seite überwiegt und die Verinnerlichung von ätherischen Ölen bis in Rhizome und Wurzeln nicht so ausgeprägt ist. Die polaren Bildeprinzipien sind zwar auch »im Gespräch« miteinander, aber sie sind nicht gleich stark, nicht ebenbürtig, und sie durchdringen sich auch nicht so innig. Bei unserer Arnika kommt aber noch ein weiterer Aspekt dazu.

Arnica latfolia, eine blattreiche nordamerikanische Art, hier im Mount Rainier National Park im US-Bundesstaat Washington.
… und Steigerung
Bezogen auf die Arnika wird hierunter verstanden, dass Arnica montana durch Zurückhaltung im Äußeren geistige Prinzipien sichtbar werden lässt.
Die aus Mexiko stammenden Zinnien mit ihren leuchtend roten, kräftigen, endständigen Blütenkörben haben ebenfalls große, gegenständige, sitzende Blätter. Bei ihnen weisen die Blattpaare wegen ihrer gleichmäßigen Verteilung entlang dem Stängel keck in vier verschiedene Richtungen. Vergleicht man hiermit blühende Arnikatriebe am natürlichen Standort, wird die »Eigenwilligkeit« der Arnika deutlich: Sie reduziert die Blattpaare am aufrechten Stängel auf zwei (bis drei) und dehnt gleichzeitig die zwischen ihnen liegenden Internodien. Der pflanzentypische Rhythmus von Ausdehnung und Zusammenziehung wird dadurch so verändert, dass Arnica montana klare, urbildhafte Zahlengebärden im Raum sichtbar werden lassen kann: Die »Vier« erscheint unübersehbar in der Jugendrosette im Kreuz, das dem Boden dicht anliegt, am Stängel ist sie abgeschwächt. Die »Drei« zeigt sich in dem dreizähligen Blütenköpfchen-Stand, der sich weit in den Lichtraum streckt (siehe Bilder Seite 18/19, 91, 98/99). Der mittlere Bereich, an dem sich bei anderen Arnikas die Fülle der gegenständigen Blätter entfaltet, bleibt bei ihr nahezu blattfrei und präsentiert unverfälscht das Wichtigste: die elastisch schwingende Aufrichte, das Organ der Ich-Qualität.
»Wer Großes will, muß sich zusammenraffen;In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.«
Diese Zeilen, mit denen Goethe ein 1807 veröffentlichtes Sonett enden lässt, weisen auf das Geheimnis der Arnica montana: Durch die Zurückhaltung in der äußeren Gestalt und die Verinnerlichung ihrer Seelenhaftigkeit wird sie zur Königin. Eine Königin kennt und verkörpert das Gesetz – aber sie prägt es individuell.
Pflege und Anbau
»Seit einigen Jahren verschwinden Pflanzen aus der Gegend, wo ich wohne, die sonst häufig da waren, zum Beispiel Gentiana ciliata, Verbena europaea, Pinguicula vulgaris. (…) Ich sehe doch nicht, dass die Arnika fehlt, von der man jährlich einen Pferdekarren voll sammelt und in Apotheken bringt« (Goethe, zitiert in MAYER/CZYGAN 2000, S. 31).
Wie sieht es seither aus? In den letzten zwei Jahrhunderten wurde die Arnika durch intensives Sammeln und den schleichenden Verlust geeigneter Lebensräume so rar, dass sie in verschiedenen Ländern Europas vom Aussterben bedroht ist und seit Langem unter Naturschutz steht. In Deutschland zählt sie zu den besonders geschützten Arten, das heißt, dass das Ausgraben und Sammeln von unter- und oberirdischen Teilen wild wachsender Pflanzen überall verboten ist; man kann aber eine offizielle Sammelgenehmigung beantragen. Die Firma WALA erntet mit Sammelgenehmigung Frischpflanzen auf gepachteten Wildstandorten, unter anderem im Schwarzwald, auf Wiesen, die durch Beweidung gepflegt werden. In Österreich und in der Schweiz sind die Einschränkungen je nach Region unterschiedlich. In Österreich dürfen Blütenköpfe in einigen Bundesländern gepflückt werden, in anderen ist die Arnika vor dem erwerbsmäßigen Handel geschützt. In der Schweiz ist sie in einigen Kantonen vollständig oder teilweise geschützt, in anderen gilt sie als nicht gefährdet (Rote Liste der gefährdeten Arten in der Schweiz 2002).
Naturschutz darf sich jedoch nicht auf ein Sammelverbot beschränken. Bedroht ist die Arnika zum einen durch eine düngungsintensive Landwirtschaft, zum anderen aber gerade durch das Fehlen einer Bewirtschaftung. Wird weder gemäht noch beweidet, verändert sich die Artenzusammensetzung der Wiesen oft so sehr, dass die Arnika verdrängt wird. Die wild wachsende Arnica montana benötigt heutzutage also die sorgsame Pflege durch verantwortungsvolle Menschen. Eine Zusammenstellung von Handlungsempfehlungen gibt das deutsche Bundesamt für Naturschutz unter https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Dokumente/Pfl_Arnimont.pdf. Sie braucht aufmerksame Bauern, die die geschützten Standorte zu den richtigen Zeiten mähen, indem sie die Fruchtreife der Arnika beachten und die Zwergsträucher in Schach halten. (Dies wird auch in unserem Arnikafilm deutlich, siehe https://tinyurl.com/arnika-heilt.) Andererseits unterstützt eine sachgemäße Beweidung auch die Ausbreitung der Arnika, da die Tiere ihr durch das Kurzhalten der übrigen Kräuter Raum und Licht verschaffen. Kühe fressen zwar die Blütenstände des giftigen weißen Germers (Veratrum album ), nicht aber die bittere Arnika! Ebenso regt das achtsame Ernten von Blütenkörben oder auch der ganzen oberirdischen Pflanzen inklusive eines kurzen Rhizomstücks die Rhizome zu einer verstärkten Vermehrung an.
Um sich die benötigten Mengen vorstellen zu können, sei auf ein Zitat von Michael Straub verwiesen: »In Europa werden pro Jahr 50 bis 60 Tonnen Arnikablüten aus Wildsammlung verarbeitet«. (MEYER und STRAUB 2011, S.55). Hinzu kommen angebaute Pflanzen. Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, fehlte es nicht an Züchtungsforschung. So berichtete Ulrich Bomme, emeritierter Professor an der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau in Freising-Weihenstephan, im Jahr 2000 von den Erfolgen einer neuen Arnica-montana-Sorte mit dem Namen ‘Arbo’ (Sortenschutz seit 1998): Sie zeige einen guten und gesunden Wuchs und einen hohen Ertrag an Blütenkörben. Bei der Sorte ‘Arbo’ bildet jede einzelne Arnikapflanze zahlreiche Rosetten, die ganz eng beieinanderbleiben, wodurch ein dichter Tuff entsteht. Die Arnikakreuze überlagern sich dadurch. Die oberirdischen Triebe entfalten sich nahezu gleichzeitig, und jeder endet mit drei oder mehr Blütenköpfen; die Zungenblüten sind dynamisch verwirbelt. Samen der Sorte ‘Arbo’ gehen im Anbau besser auf als Samen aus Wildherkünften, sie sind auch nicht so anspruchsvoll in Bezug auf die Bodenverhältnisse. Die erfolgreiche Einführung dieser Sorte führte dazu, dass seit 2000 die amerikanische Arnica chamissonis nicht mehr als Bestandteil von »Arnikablüten« gestattet ist (European Pharmacopeia 9, 2016, siehe auch Seite 30). Saatgut der Sorte ‘Arbo’ kann man beim Templiner Kräutergarten oder über Jelitto Staudensamen erhalten.
Читать дальше