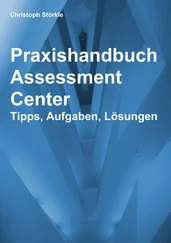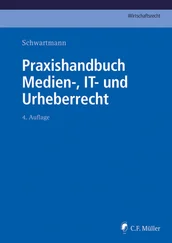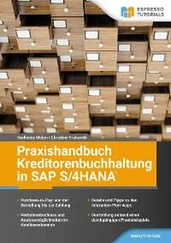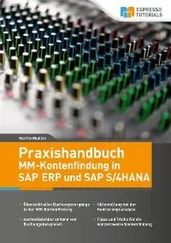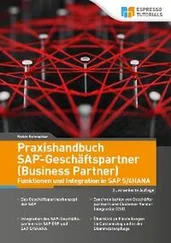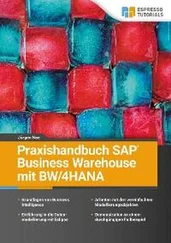• Um den Hilfebedarf und die Versorgungssituation für chronisch kranke alte Menschen adäquat beurteilen zu können, sind epidemiologische Studien erforderlich, die alle Versorgungsbereiche berücksichtigen: pflegende Angehörige, Selbsthilfegruppen, ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen der Altenhilfe, primär- und fachärztlicher Bereich und Krankenhäuser (  Kap. 51,
Kap. 51,  Kap. 52, und
Kap. 52, und  Kap. 58).
Kap. 58).
Beaglehole R, Bonita R, Kjellström T (1997) Einführung in die Epidemiologie. Bern: Huber.
Colvez A, Blanchet M (1981) Disability trends in the United States population 1966–76: analysis of reported causes. American Journal of Public Health 5: 464–471.
Crimmins EM, Beltran-Sanchez H (2010) Mortality and morbidity trends: Is there compression of morbidity? Journal of Gerontology: Social Sciences 1: 75–86.
Deutscher Bundestag (2002) Schlussbericht der Enquete-Kommission »Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik«. Drucksache 14/8800.
Fries JF (1980) Aging, natural death, and the compression of morbidity. New England Journal of Medicine 3: 130–135.
Fries JF, Bruce B, Chakravarty E (2011) Compression of morbidity 1980–2011: A focused review of paradigms and progress. Journal of Aging Research. (doi: 10.4061/2011/261702).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2018) Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter von … Jahren je Person. Gliederungsmerkmale: Zeitraum, Region, Alter, Geschlecht. Berlin: Robert Koch-Institut. (www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=73991360&nummer=524&p_sprache=D&p_indsp=-&p_aid=20367780, Zugriff am 27.08.2018).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Gemeinsam getragen von RKI und Destatis (2015) Gesundheit in Deutschland. Berlin: Robert Koch-Institut.
Gruenberg EM (1977) The failure of success. Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society 1: 3–24.
Heigl A (2002) Aktive Lebenserwartung: Konzeptionen und neuer Modellansatz. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 35: 519–527.
Hoffmann E, Menning S, Schelhase T (2009a) Demografische Perspektiven zum Altern und zum Alter. In: Böhm K, Tesch-Römer C, Ziese T (Hrsg.) Gesundheit und Krankheit im Alter. Berlin: Robert Koch-Institut. S. 21–30.
Hoffmann E, Schelhase T, Menning S (2009b) Lebenserwartung und Sterbegeschehen. In: Böhm K, Tesch-Römer C, Ziese T (Hrsg.) Gesundheit und Krankheit im Alter. Berlin: Robert Koch-Institut. S. 92–104.
Kibele E, Scholz R, Shkolnikov VM (2008) Low migrant mortality in Germany for men aged 65 and older: fact or artifact? European Journal of Epidemiology 23: 389–393.
Kröhnert S, Karsch M (2011) Sterblichkeit und Todesursachen. Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Stand: Juli 2011.
Kroll LE, Ziese T (2009) Kompression oder Expansion der Morbidität? In: Böhm K, Tesch-Römer C, Ziese T (Hrsg.) Gesundheit und Krankheit im Alter. Berlin: Robert Koch-Institut. S. 105–112.
McKinlay JB, McKinlay SM, Beaglehole R (1989) A review of the evidence concerning the impact of medical measures on recent mortality and morbidity in the United States. International Journal of Health Services Research 2: 181–208.
Münz R (2007) Fertilität und Geburtenentwicklung. Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Stand: Oktober 2007.
Neyer G (2003) Family policies and low fertility in Western Europe. Journal of Population and Social Security (Population) 1 (Suppl): 46–93.
Sanderson WC, Scherbov S (2005) Average remaining lifetimes can increase as human population age. Nature 7043: 811–813.
Sanderson WC, Scherbov S (2010) Remeasuring aging. Science 5997: 1287–1288.
Scherbov S, Sanderson W (2010) Negative Folgen der Alterung bislang überbewertet. Neue Maßzahlen für aktuelle Bevölkerungsentwicklung. Demografische Forschung 4: 1–2.
Statistisches Bundesamt (2009). Bevölkerung Deutschlands bis 2060. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
Statistisches Bundesamt (2011) Ältere Menschen in Deutschland und der EU. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
Statistisches Bundesamt (2016) Ältere Menschen in Deutschland und der EU. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
Statistisches Bundesamt (2017a) Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2016 – Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
Statistisches Bundesamt (2017b) Todesursachen in Deutschland. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
Statistisches Bundesamt (2017c) Pflegestatistik 2015. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. Deutschlandergebnisse. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
Tivig TF, Waldenberger F (Hrsg.) (2011) Deutschland im Demografischen Wandel. Rostocker Zentrum zur Erforschung des demografischen Wandels.
Weyerer S (2005) Altersdemenz. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 28. Berlin: Robert Koch-Institut.
Weyerer S, Bickel H (2007) Epidemiologie psychischer Erkrankungen im höheren Lebensalter. Grundriss Gerontologie, Band 14. Stuttgart: Kohlhammer.
Weyerer S, Ding-Greiner C, Marwedel U, Kaufeler T (2008) Epidemiologie körperlicher Erkrankungen und Einschränkungen im Alter. Grundriss Gerontologie, Band 13. Stuttgart: Kohlhammer.
Danksagung:
Diese Arbeit wurde unterstützt durch das INTERREG IVB NWE Projekt »Health & Demographic Changes«.
3 Die Disziplinen stellen sich vor
3.1 Geriatrie
Cornelius Bollheimer und Dieter Lüttje
3.1.1 Aufgabengebiet
Nach der gültigen europäischen Konsensusdefinition aus dem Jahre 2008 versteht sich die Geriatrie als (a.) das zuständige medizinische Fachgebiet für Alterungsprozesse sowie (b.) für präventive, diagnostische, therapeutische, rehabilitative und palliativmedizinische Aspekte von Erkrankungen bei Menschen ab ungefähr 65 Jahren (sog. Malta-Definition, UEMS-GMS 2008). Die Geriatrie ist damit auf den ersten Blick wie die Kinder- und Jugendheilkunde eine altersdefinierte Fachdisziplin, wobei jedoch das kalendarische Alter als hinreichendes Eingangskriterium für die geriatrische Zuständigkeit relativiert werden muss.
Nach dem in Deutschland üblichen Verständnis und konsentiert durch die maßgeblichen Fachgesellschaften (DGG, DGGG) und Berufsorganisation (BVG) ist ein Patientenalter unter 80 Lebensjahren nur dann in einen geriatrischen Kontext zu bringen, wenn eine sogenannte Geriatrie-typische Multimorbidität vorliegt (  Kap. 5.3).
Kap. 5.3).
Konkretisierende Ausführungen zu dem abstrakten Begriff der Geriatrie-typischen Multimorbidität finden sich in der Begutachtungsanleitung zur Vorsorge und Rehabilitation des MDS (Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen) aus dem Jahre 2018: Demnach beschreibt Geriatrie-typische Multimorbidität das Vorliegen von mindestens zwei Erkrankungen mit sozialmedizinischer Relevanz, wozu entsprechend der International Classification of Functioning (ICF,  Kap. 45) sog. aktivitätsbeeinträchtigende Schädigungen identifiziert werden müssen. Solche Schädigungen können z. B. einem klassischen geriatrischen Syndrom (Inkontinenz, s. u.) entsprechen oder aber auch ein psychisches (kognitives Defizit, Altersdepression) bzw. organisches Korrelat (Dekubitus) besitzen. Der MDS hat hierfür eine entsprechende Liste mit Ankerbegriffen zusammengestellt (MDS 2018).
Kap. 45) sog. aktivitätsbeeinträchtigende Schädigungen identifiziert werden müssen. Solche Schädigungen können z. B. einem klassischen geriatrischen Syndrom (Inkontinenz, s. u.) entsprechen oder aber auch ein psychisches (kognitives Defizit, Altersdepression) bzw. organisches Korrelat (Dekubitus) besitzen. Der MDS hat hierfür eine entsprechende Liste mit Ankerbegriffen zusammengestellt (MDS 2018).
Читать дальше
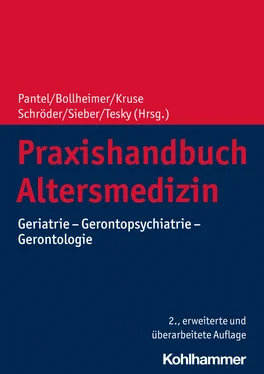
 Kap. 51,
Kap. 51,