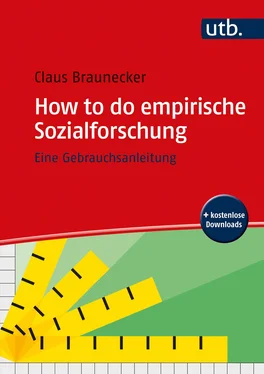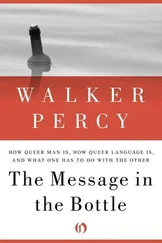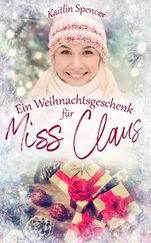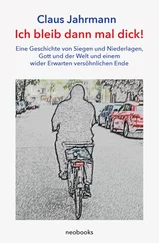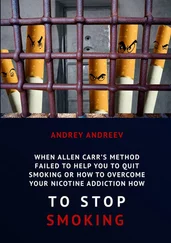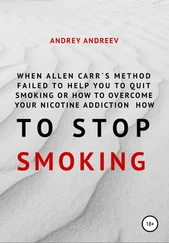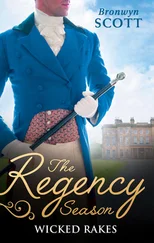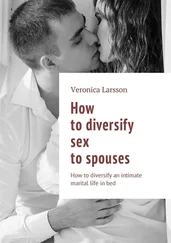7Ab dieser Stelle wird in diesem Kapitel zur Demonstration technisch und nicht real theoriegestützt argumentiert.
8Mit „Leseaffinität‟ ist hier „Hinwendung, Neigung zum Lesen‟ (= „gerne lesen‟) gemeint.
9Darin unterscheiden sich sozialwissenschaftliche Fragestellungen von naturwissenschaftlichen: Dort werden oft deterministische Hypothesen („in 100% aller Fälle‟, z.B. physikalische Gesetze) aufgestellt: „Wenn eine Person ein (unverpacktes) Buch ins Wasser fallen lässt, dann wird es nass.‟
10Grundsätzlich setzt jede der hier angeführten Formulierungen eine vorangegangene (Literatur-)Recherche voraus, aus der die jeweilige hypothetische Annahme abgeleitet werden kann. Zur leichteren Lesbarkeit wird in den folgenden Beispielen auf die Präzisierung, auf WEN (z.B. österreichische Wohnbevölkerung) sich die jeweilige Hypothese bezieht, verzichtet. Diese (wiederholte) Präzisierung ist in der Realität einer wissenschaftlichen Arbeit aber ratsam.
11Die theoretischen und datenanalytischen Grundlagen zur überprüfung statistischer Hypothesen werden im Detail bei Braunecker 2021: 77ff. behandelt.
12Ob sie das tatsächlich müssen/sollten oder auch Formulierungen als „noindent1e‟ Aussagesätze möglich sind, wird in der wissenschaftlichen Praxis nicht ganz übereinstimmend betrachtet.
2 | Qualitative und quantitative Forschungsmethoden
… in diesem Kapitel geht’s um:
| ● Qualitativforschen: Inhaltliche Tiefe steht im Vordergrund • „Warum“, beschreiben, Motive • bei neuen Themen • zur Erforschung von Dimensionen • vor allem individuelle und psychologische Aspekte • überschaubare Erhebungsanzahl • kein einheitlicher Fragebogen (dafür Leitfaden) • verbalisierte Ergebnisse • KEINE Statistik |
| ● Quantitativforschen: Ergebnisse auf zahlenmäßig breiter Basis • Abtestung „bekannter“ Zustände • zahlenmäßige Interpretationen • große Menge an Erhebungen • standardisierter Fragebogen • Prozentzahlen, Mittelwerte • Statistik |
| ● Inhaltsanalyse:Zählen oder Bewerten von Aussagen oder anderen klar definierten Inhalten • in Print-, elektronischen und Online-Medien • Codierschema • wenn automatisiert: „Sentiment-Problem“ |
| ● Beobachtung:objektiviertes Erfassen von Situationen, Handlungen und Verhaltensweisen • Beobachtungsbogen • Eyetracking, Mystery-Tests |
| ● Fokusgruppe:Diskussionsrunde kleiner Gruppen (sechs bis 12 Personen) • moderiert • Leitfaden • Dauer ein bis zwei Stunden |
| ● Qualitative Befragung:Einzelgespräche aus Befragtenperspektive • überwiegend freier Gesprächsverlauf oder zumindest frei formulierbare Fragen • ausschließlich oder überwiegend offene Fragen |
| ● Quantitative Befragung:(voll) standardisierte Interviews • (fast) ausschließlich geschlossene Fragen • KEIN Spielraum für die Befragerin oder den Befrager • F2F, PAPI, CAPI, CATI, CAWI, WATI • Mehrthemenumfrage MTU („Omnibusbefragung“) • Hybrid- bzw. Mixed-Mode-Befragungen • Panel, Tracking |
| ● Experiment:Analyse von Ursache-Wirkung-Beziehungen • Versuchs- und Kontrollgruppe |
Thema, Erkenntnisinteresse(n), Forschungsfragen und/oder Hypothesen geben vor 13, ob eine Erhebung qualitativ, quantitativ oder in Kombination erfolgt. Worin unterscheidet sich nun das Wesen qualitativer von quantitativer Empirie?
2.1 | Qualitative Methoden
Qualitative Methoden gehen der Frage nach einzelnen Motiven und Inhalten nach. Sie beschreiben inhaltliche Dimensionen verbal, oft auch interpretativ, erforschen Werte, [22] Gefühle, Details, das Warum bzw. Wie von „Tun“. Im Vordergrund stehen weniger Erhebungsmengen als vielmehr inhaltliche Tiefe.
Qualitative Empirie beschäftigt sich deshalb mit einer eher geringeren Anzahl an Untersuchungsobjekten, die sie dafür aber sehr umfangreich und im Detail beleuchtet.
Dazu werden eher „offene‟, in Details noch flexibel gestaltbare Erhebungsinstrumente eingesetzt: Sie können direkt während ihres Einsatzes noch feinjustiert werden.
So skizziert z.B. ein Gesprächsleitfaden bloß die Inhalte eines qualitativen Interviews. Wortwahl und Abfolge der Themen können dem Gesprächsverlauf angepasst werden.
Statistiken, große Stichproben und Signifikanzprüfungen sind in der qualitativen Forschungswelt kein oder kaum Thema. Prozent- und Mittelwerte sowie andere Maßzahlen finden sich hier nur am Rande.
Qualitative Erhebungen beschäftigen sich z.B. mit dem Warum von (Kauf-)Entscheidun- gen, mit „im Hinterkopf schlummernden‟ Motiven. Andere Ansätze erkunden bzw. detaillieren Qualitäts- oder Kundenzufriedenheitsdimensionen oder analysieren Images. Auch Expertengespräche sind fast immer qualitativ angelegt. Ebenso basiert die Erforschung von Ursachen jeglicher Art fast immer auf qualitativer Empirie. Nicht zuletzt beschreitet die beschreibende Bewertung von Aussagen und Inhalten qualitative Wege.
In der qualitativen Erhebungswelt geht es um Vorstudien, Hypothesenfindung, vertiefte Problem(er)kenntnis und Detailinformation. Anlassfall können - v.a. in der Wirtschaft - auch kurzfristig benötigte dringende Entscheidungshilfen sein. 14
Qualitative Ansätze werden oft auch mit quantitativen Verfahren kombiniert.
Analysen der Kundenzufriedenheit z.B. liefern meist Zufriedenheitskennzahlen. Oft sind diese Kennzahlen (noch) nicht erhebbar, weil niemand weiß, welche überhaupt die richtigen sind. Was Kundenzufriedenheit jeweils ausmacht, kann im Vorfeld durch qualitative Forschung erhoben werden. Das werden bei Autos wohl ganz andere Kriterien sein als etwa bei Schokolade, Waschmittel oder einem speziellen Dienstleistungs-Startup.
Qualitative Forschung hat ihren Platz aber nicht nur VOR, sondern auch NACH quantitativen Erhebungen: Auf diese Weise werden quantitative Zahlen zusätzlich mit Inhalten belegt.
Nach einer quantitativen Imageanalyse kann es z.B. von Interesse sein, im Nachhinein die besten (oder schlechtesten) Imagekriterien zu detaillieren: Was bedeutet z.B. ein guter Wert bei „modern‟? Woraus leitet sich empfundene Modernität inhaltlich genau ab usw.?
2.2 | Quantitative Methoden
Quantitative Methoden verfolgen den Ansatz zu zählen: also nicht verbal auszuformulieren, sondern rein zahlenmäßig zu quantifizieren und daraus Interpretationen abzuleiten.
[23]
Quantitative Forschung entdeckt keine (weiteren) neuen Zugänge zu einem Thema (höchstens am Rande): Hier wird bereits „Bekanntes‟ erforscht, die Antwortalternativen bzw. möglichen Ergebnisausprägungen sind bereits vor der Erhebung fixiert.
Um gut quantifizieren zu können, kommen meist große Stichproben (oder Vollerhebungen) zum Einsatz.
Quantitative Erhebungsinstrumente erlauben nur sehr wenig, meist sogar überhaupt keinen Spielraum während der Erhebung.
Ein standardisierter Fragebogen z.B. wird jeder befragten Person in völlig identer Form vorgelegt (vorgelesen). Die Wortwahl und Abfolge der Themen sind streng vorgegeben und dürfen nicht variiert werden.
Die Analyse quantitativer Daten wirft Häufigkeiten, Prozentwerte, Mittelwerte und weitere statistische Maßzahlen aus. Oft mündet sie auch in detaillierte und berechnungsintensivere Statistiken und Signifikanzprüfungen.
Im Zuge quantitativer Forschung werden konkret ausgewählte Merkmalsbeschreibungen systematisch einem zuvor festgelegten Kategoriensystem zugeordnet und auf zahlenmäßig breiter Basis gesammelt. Hier steht das Bestreben im Vordergrund, möglichst klare und eindeutige Informationen zu generieren. „Nackte‟ Zahlen werden erhoben, ausgewertet und interpretiert, signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Menschen oder Erhebungsgegenständen gesucht, erklärt und gedeutet.
Читать дальше