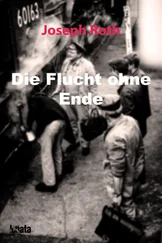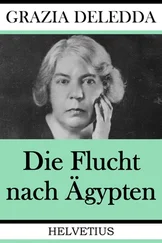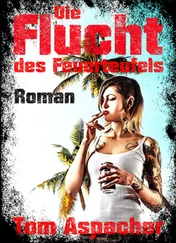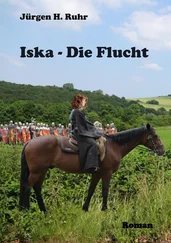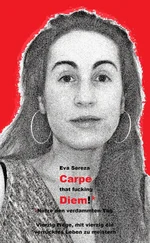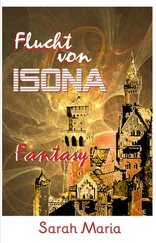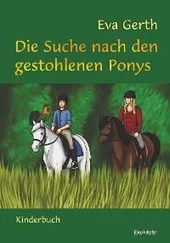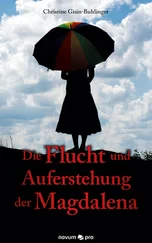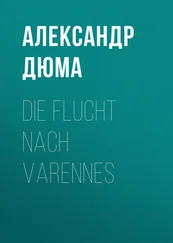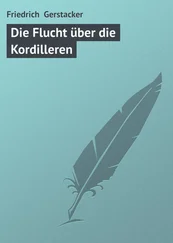Wir kommen damit zu dem Ergebnis, daß im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts die von der Judenfrage ausgehenden objektiven gesellschaftlichen Spannungen sich ständig vermindert haben; daß aber zur gleichen Zeit kollektive Unlustgefühle, die aus anderen Quellen herrührten, sowohl chronisch – durch die Komplikationen des industriellen Wirtschaftssystems – als auch akut – infolge von Konjunkturkrisen – zunahmen. Politischen Führern, die die Brauchbarkeit antisemitischer Methoden zum Erreichen anderweitiger politischer Zwecke erkannten, gelang es mit bemerkenswertem Erfolg, die subjektiven Unlustgefühle breiter Bevölkerungskreise in das sich zwar ständig verflachende, aber doch noch immer vorhandene Strombett des jüdisch-nichtjüdischen Gruppengegensatzes hineinzuleiten.
*Die Zahl der Juden in Deutschland betrug 1820 etwa 270 000 oder 1,9 % der Bevölkerung; sie war 1925 auf 564 379 oder um 0,90 % gestiegen. (Nach Jakob Lestschinski , Das wirtschaftliche Schicksal des deutschen Judentums, S. 50)
**Das schließt nicht aus, daß die Juden in Deutschland in großem Umfange auch das verwirklichten, was Julian Morgenstern (Assimilation, Isolation, or Reform? Contemporary Jewish Record) „active assimilation“, „the process … of assimilating without being assimilated” nennt. Es handelt sich hier nur um eine andere Ausdrucksweise, nicht um einen Widerspruch der Auffassung. Indem die Juden sich (sibi) die Art der Umwelt assimilieren, assimilieren sie sich (se) gleichzeitig an die Umwelt. Die Gründung der Wissenschaft des Judentums zum Beispiel durch Leopold Zunz ist ein solcher Akt aktiver und passiver Assimilation zugleich; indem man die wissenschaftlichen Methoden der Umwelt in den Dienst jüdischer Forschung stellte, interpretierte man doch auch den geistigen Gehalt des Judentums und machte ihn für die Umwelt verständlich und damit akzeptabel.
* A. J. Toynbee , A Study in History, bezeichnet den Zusammenhang zwischen Diskriminierung und Intensität der jüdischen Substanz als soziales Gesetz. Bd. II, S. 248: „So finden wir bei den Juden eine Stufenleiter von Typen – aschkenasische Juden, sephardische Juden, Doenme, heimliche Juden und jüdische Katholiken –, bei denen die Dichte der jüdischen Substanz gradweise von einem Maximum bis nahezu zum Nullpunkt abgestuft ist; und wir bemerken, daß die Unterschiede in der Dichte der jüdischen Substanz den Unterschieden in der Heftigkeit der Bedrückung entsprechen, denen die Juden seitens der nichtjüdischen Umwelt ausgesetzt waren. Die sich von der Umwelt unterscheidende Substanz der unterdrückten religiösen Gruppe verliert sich mehr und mehr in dem Grade, in dem die Unterdrückung nachläßt; und dieses soziale Gesetz gilt nicht nur für die Juden. Seine Geltung kann auch für andere unterdrückte Sekten nachgewiesen werden.“ Toynbee vernachlässigt die anderen Faktoren, von denen die Intensität der jüdischen Substanz abhängt, vor allem die Länge der zurückliegenden Assimilationszeit, eventuelle Zuwanderung von jüdischen Gruppen intensiver Substanz und so weiter.
*Wir können uns mit der Frage der rassischen Homogenität der Juden nicht näher beschäftigen, doch sei folgendes über den Zusammenhang zwischen Rasse und Gruppe gesagt: Der rassische Faktor, der nicht einfach abgestreift, sondern höchstens durch Mischheirat verdünnt werden kann, genügt für sich allein nicht, um die Zugehörigkeit zu einer jüdischen Gruppe zu begründen. Es gibt rassische „Volljuden“, die alle Beziehungen zur jüdischen Gemeinschaft gelöst haben, und Personen ohne einen Tropfen jüdischen Blutes, die zu ihr gehören. Die Betonung des Rassenkriteriums seitens der Antisemiten entspricht deren Wunsch, einen unveränderlichen Faktor zur Grundlage der jüdischen Gruppenexistenz zu machen.
*Daß der objektive Gruppencharakter stärker war als das schwindende subjektive Gruppenbewußtsein, geht aus der Anomalie der jüdischen Berufsgliederung hervor. Die Juden in Italien stellten zwar charakteristischerweise einen etwas geringeren Prozentsatz zu den Berufen des Handels und Verkehrs als in Deutschland; von je 100 berufstätigen Juden 41,5 % im Jahre 1910 gegenüber 69,4 % in Bayern im Jahre 1907 und 49,7 % in Deutschland im Jahre 1907, s. Ruppin , Soziologie, Bd. 1, S. 348; immerhin aber waren noch sechsmal mehr Juden in Handel und Verkehr beschäftigt als ihrem Bevölkerungsanteil entsprach, nämlich 0,6 % gegenüber ihrem Bevölkerungsanteil von 0,1 % (Ruppin , a. a. O. Bd. 1, S. 357). Was aber die Anomalie noch verstärkte, war die Tatsache, daß der Überschuß der früher in Handelsberufen Tätigen offenbar in die freien Berufe und Beamtenstellungen abströmte, in denen nicht weniger als 23 % aller erwerbstätigen Juden beschäftigt waren (Ruppin , a. a. O., Bd. 1, S. 350).
*Vgl. Bernstein , a. a. O., S. 219: „Die zwischen den Gruppen herrschende Spannung und die zur Äußerung gelangende Feindschaft ist keineswegs das Produkt von Eigenschaften oder Handlungen der Gegengruppe.“ Zweig , a. a. O., S. 30: „Das Wesen des Juden ist für das Zustandekommen des Antisemitismus ganz außer acht zu lassen.“
* W. Trotter , a. a. O., S. 32: „Alles, was dazu neigt, die Unterschiede von der Herde zu betonen, wird als unangenehm empfunden. Das Individuum hat eine nicht zu erklärende Abneigung gegen jede Neuerung im Tun und Denken.“
*Welche Bedeutung Simmel dieser Unterscheidung beimißt, geht aus der folgenden Fußnote zu S. 263 seiner „Soziologie“ hervor: „Alle Verhältnisse eines Menschen zu anderen sind in ihrem tiefsten Grund nach dieser Frage geschieden – wenn auch in unzähligen Übergängen zwischen ihrem Ja und Nein –: ob ihre seelische Grundlage ein Trieb des Subjektes ist, der sich, als Trieb, auch ohne jede äußere Anregung entwickelt und erst seinerseits einen ihm adäquaten Gegenstand sucht, sei es, daß es ihn als adäquaten vorfindet, sei es, daß es ihn durch Phantasie und Bedürfnis bis zur Adäquatheit umgestaltet; oder ob die seelische Grundlage in der Reaktion besteht, die das Sein und Tun einer Persönlichkeit in uns hervorruft; natürlich müssen auch zu ihr die Möglichkeiten in uns vorhanden sein, aber sie wären an sich latent geblieben und hätten sich nie von selbst zu Trieben gestaltet. In diesen Gegensatz stellen sich intellektuelle wie ästhetische, sympathische wie antipathische Verhältnisse zu Menschen ein und ziehen häufig nur aus diesem Fundamente ihre Entwicklungsformel, ihre Intensität und ihre Peripetie.“
*Vgl. auch Harold O. Lasswell , World Politics and Personal Insecurity, S. 177; „Menschen, die die Umgebung, in der sie groß geworden sind, verlassen, zeigen in der neuen Umgebung verschiedene Grade persönlicher Anpassungsschwierigkeiten. In ihrer ursprünglichen Umgebung dienten Familie, Kirche, Schule, Freunde und Nachbarn als immer von neuem wirksame Antriebe zur Beibehaltung erworbener Hemmungen. In der neuen Umgebung fallen solche äußeren Stützen für das Über-Ich häufig fort; ja die alten Symbole fehlen vielleicht nicht nur, sondern sie werden von der neuen Umgebung manchmal sogar mit offener Nichtachtung behandelt.“ Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, daß es uns nicht um Apologetik geht, weshalb mit der einfachen Gegenbehauptung, daß die weitaus überwiegende Mehrheit der Juden in der Intensität ihrer religiösen Bedingungen sich nicht von ihrer Umwelt unterscheidet, nichts gewonnen wäre. Wie dünn auch immer die Schicht der jüdischen Irreligiösen im Vergleich zu den religiös Gebundenen sein mag, die ihr zuteilgewordene öffentliche Aufmerksamkeit macht es wünschenswert, auf die Entstehung und Wirkung der Erscheinung näher einzugehen.
*Von den Schwierigkeiten, die dieser Tendenz in Amerika entgegenstehen, gibt Leonhard Bloom , The Jews of Buna, in: Jews in a Gentile World, S. 195 u. S. 197, ein interessantes Bild.
Читать дальше