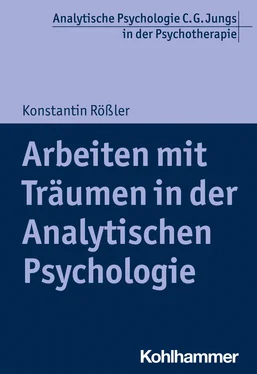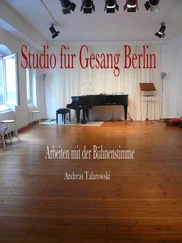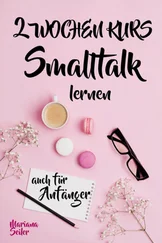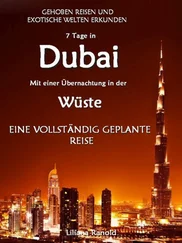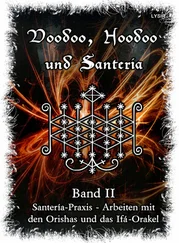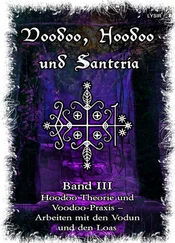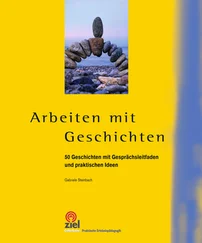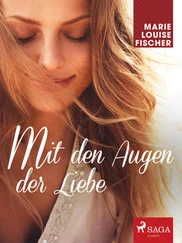Lässt man sich innerlich auf die Atmosphäre eines solchen Ortes ein, wird nachfühlbar, dass Träume, die in diesem besonderen Raum geträumt werden, sehr eindrückliche Spuren hinterlassen können. Es ist naheliegend, dass Menschen, die sich diesem Prozess für einige Tage, Wochen oder gar längere Zeit aussetzten, verändert daraus hervorgingen und Entwicklungen für sie angestoßen wurden. Der Traum wurde so zu einem Orakel und einem wichtigen Instrument im Prozess von Krankheit und Heilung.
Eine Besonderheit in der antiken Literatur zum Traum stellt das Standardwerk »Das Traumbuch« des Artemidor von Daldis dar, der als der bekannteste Traumdeuter seiner Zeit gilt und mit dieser Tätigkeit seinen Lebensunterhalt verdiente. Für ihn besteht der wesentliche Sinn von Träumen darin, Voraussagen über die Zukunft zu erhalten. Jedoch vertritt er auch Grundauffassungen zum Traum, die heute noch Verwendung im therapeutischen Kontext finden. So unterscheidet er zwischen den beiden Kategorien des Traums (enhypnion) und des Traumgesichts (oneiros), wobei letzteres die eigentlich aussagekräftigen Informationen enthält. Das, was Artemidor als herkömmlichen Traum bezeichnet, entspricht am ehesten der Wiedergabe von Tagesresten, wobei diese bei Artemidor vor allem an körperliche Bedürfnisse geknüpft sind, die etwas missverständlich als »Affekte« übersetzt werden: »Es gibt gewisse Affekte, die so geartet sind, daß sie im Schlaf wieder emporsteigen, sich der Seele wieder darbieten und Träume hervorrufen.« (Artemidor, 1979, S. 9). Der Hungrige träume demnach vom Essen, der Durstige vom Trinken, der Liebhaber von seinem Lieblingsknaben. Der Inhalt solcher Träume wirke jedoch im Wachen nicht nach. Bei Traumgesichten hingegen wirke dieses weiter: »nach dem Schlaf aber erweckt und erregt es seiner Natur gemäß die Seele, indem es zu aktivem Handeln antreibt.« (Artemidor, 1979, S. 10). Artemidor stellt ganze Deutungskataloge von Traumsymbolen auf, die auf einem relativ konkretistischen Symbolverständnis gründen, das sehr an die Anfänge der Freudschen Symboldeutung in Träumen erinnert: »Allegorisch sind diejenigen Traumgesichte, die ein Ding durch ein anderes anzeigen, wobei die Seele auf natürliche Weise in ihnen mit verhüllten Anspielungen spricht.« (Artemidor, 1979, S. 11). Er geht aber noch weiter und entwirft eine Kategorisierung in mehrere Klassen von Träumen, in denen sich Konzepte der Analytischen Psychologie wie das der Subjekt- und Objekt-Stufe oder kollektive und archetypische Trauminhalte, die er als »kosmische Traumgesichte« bezeichnet, mühelos wiederfinden lassen.
1.3 Der Traum in Spätantike und christlichem Mittelalter
Eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit unsere Träume Ausdruck einer Spannung zwischen Ich-Bewusstsein und unbewussten Inhalten sind, finden wir schon in der Spätantike bei Augustinus (354–430 n. Chr.): »Bin ich dann nicht ich, Herr mein Gott?… Und doch ist ein Unterschied zwischen mir und mir. (…) und ich finde eben wegen dieser Verschiedenheit von mir selbst, daß ich das nicht getan habe, wiewohl es mich schmerzt, daß es gewissermaßen in mir geschehen ist.« (zit. nach von Siebenthal, 1953, S. 78f.). An anderer Stelle fügt Augustinus anlässlich von erotischen Träumen, die er als Versuchung erlebt, die Frage hinzu: »Bin ich denn, Herr, mein Gott nicht auch im Schlafe ich selbst?« (zit. nach Schnocks, 2007, S. 28).
Die Frage, ob wir verantwortlich sind für das, was wir träumen, hat unter Berufung auf Augustinus für Autoren des Mittelalters und der Renaissance mitunter erhebliche Konsequenzen. Im Traktat des Thomas Careña aus dem Jahre 1659 wird Inquisitoren empfohlen, die im Schlaf erhaltenen Träume als Ausdruck dessen anzusehen, »was unter Tags jemand beschäftigt hat«. (von Siebenthal, 1953, S. 79), und sie als Material für die inquisitorische Untersuchung zu verwenden. Es braucht nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, wie gefährlich es war, in dieser Zeit die oft bizarr wirkenden Inhalte eigener Träume weiterzuerzählen, und wie leicht damit Verurteilungen durch die Inquisition begründet werden können.
Im Mittelalter zeichnet sich die zweigleisige Beurteilung des Wesens der Träume bereits deutlich ab. So wird zwischen natürlichen und übernatürlichen Träumen unterschieden. Vor allem zukunftsgerichtete Träume stammen unmittelbar von Gott oder den Engeln, die schlechten vom Teufel. Der Traumvorgang selbst ist dagegen etwas völlig Natürliches, das mit spekulativen und empirischen Modellen erklärt wird. So beschreibt Albertus Magnus bereits eine Abriegelung der Sinnesorgane im Schlaf, die es ermöglicht, dass sich die virtus imaginativa als eine Fähigkeit zur bildlichen Vorstellung in Gestalt des Traums und als etwas von innen Kommendes entfalten kann (vgl. von Siebenthal, 1953, S. 79ff.). Nicht alle Träume jedoch haben demnach eine übernatürliche Ursache, sie können auch Täuschungen enthalten, mit denen sich das Wachbewusstsein, der Intellekt, auseinandersetzen muss. Hier steht vor allem die Aufgabe der Differenzierung zwischen Imagination und objektivierbarer Wahrnehmung im Wachbewusstsein im Vordergrund. Mit dieser Auffassung beziehen sich Autoren wie Albertus Magnus auf die oben erwähnte Argumentation des Aristoteles und lassen bereits eine Vorbereitung der rationalen Grundhaltung der späteren Aufklärung gegenüber dem Traumphänomen erkennbar werden.
1.4 Der Traum in der Tradition von Aufklärung und Romantik
Wie eng die beiden konkurrierenden Auffassungen von Bedeutsamkeit oder Bedeutungslosigkeit des Traums beieinander liegen, lässt sich in den konträren Haltungen der Aufklärung und der Romantik zum Traum weiterverfolgen.
Interessanterweise stellt ausgerechnet ein Traum die entscheidende Zäsur im Leben René Descartes’ (1596–1650) dar, der als Vertreter des Rationalismus und Vorläufer der Aufklärung wesentliche Grundlagen eines dualistischen Weltbilds mit einer Trennung von Geist und Materie schafft, die noch heute die naturwissenschaftliche Forschung auch der Traumphänomene bestimmt. Descartes hält diesen Traum, den er am 10. November 1619 als Freiwilliger der bayerischen Armee unter General Tilly im Dreißigjährigen Krieg träumt, für so wichtig, dass er sich intensiv mit ihm auseinandersetzt, ihn veröffentlicht und als eine Art Erleuchtungserlebnis empfindet. In diesem Traum offenbare sich ihm der »Geist der Wahrheit« (von Franz, 2002, S. 159), der ihm die »Schätze aller Wissenschaften« zugänglich mache und der zur Grundlage seiner Wissenschaftstheorie wird. Dies hält ihn jedoch nicht davon ab, am Ende seines Lebens Träume als »Schatten der Seele« (Alt, 2011, S. 132) zu bezeichnen, deren Ursache nicht klar erkennbar sei.
In der aufgeklärten Literatur gerät der Traum als Ausdruck der Irrationalität und Gegenspieler des von der Vernunft geleiteten Bewusstseins in den »Bannkreis einer Defizithypothese« (Alt, 2011, S. 140), da im Traum offenbar die Abwesenheit zentraler Kategorien wie Wahrheit, Vernunft, Wahrnehmung, Gedächtnis und nach Hume vor allem des Bewusstseins herrsche (Alt, 2011, S. 138). Die anarchischen Vorgänge der Traumhandlungen sind mit den Mitteln der rational-kritischen Betrachtungsweise nicht zu erfassen. Der Traum wird als Widersacher der ratio eingeordnet, der sich jeder Erkenntnis verschließt: »Er erscheint wie ein Einbrecher in der Nacht, der bemerkt, daß der Hausherr, den er berauben möchte, verreist ist.« (Alt, 2011, S. 138). Für das in der Aufklärung mühsam errungene rationale Paradigma als Basis jedes Erkenntnisgewinns stellt der Traumzustand mit seinen bizarren Bildern und Handlungen eine regelrechte Bedrohung dar und ruft eine Abwehrbewegung hervor, die den Traum in die Nähe des Wahnsinns rückt: »Traum und Wahnsinn teilen im Zeitalter der Vernunft eine – freilich graduell unterschiedene – Tendenz, rationale Sinnstrukturen durch die Neukombination ihrer Bestandteile zu verfremden.« (Alt, 2011, S. 133).
Читать дальше