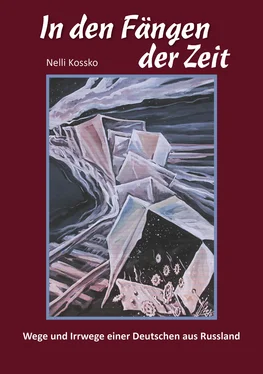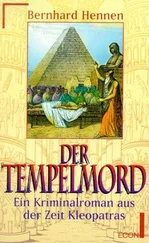„Pah!“, meinte Klara schnippisch, „unsere Mama hat ihn uns gezeigt und gesagt, wir sollen uns dieses Gesicht gut einprägen, denn niemand, so hat sie gesagt, niemand auf der Welt hat den Deutschen in Russland so viel Leid angetan wie dieser, warte mal, Lore, wie hat Mama noch gesagt?, ach ja, wie dieser Tyrann!“
Ich drückte meine Nase noch einmal an die Bretterwand und sah durch den Spalt: Der Tyrann lächelte mir freundlich zu, ein gutmütiger Opa, fast wie ein wahrhaftiger Weihnachtsmann.
Nebenan giftete die „Hexe“.
„Wie ihr das bloß aushalten könnt“, sagte ich in die Stille und schlug vor, völlig unerwartet für mich selbst, zu unserer Tante Njura zu gehen.
Doch Klara und Lore hatten Angst, dass ihre Hauswirtin sie womöglich nicht mehr ins Haus lassen würde.
„Ach was, dann bleibt ihr eben bei uns, bis unsere Mütter von der Arbeit kommen. Wir können es uns auf dem Ofen gemütlich machen und vielleicht etwas spielen. Wenn ihr wüsstet, wie schön warm es da oben ist!“ Der Ofen gab den Ausschlag, und meine Freundinnen begannen sich in größter Eile anzuziehen. Als wir dann durch die Küche gingen, schrie uns die „Hexe“ an und zeigte auf die Pfützen auf dem Boden, die sich offensichtlich vom Schnee an meinen Schuhen gebildet hatten. Klara holte einen Lappen und wischte alles weg, dann flüchteten wir vor dem Geschrei der Wirtin nach draußen.
Doch da war es auch nicht viel stiller. Ganz plötzlich hatte sich das Wetter geändert, der wildgewordene Wind wirbelte den Schnee durch die Luft, warf ihn uns ins Gesicht, zerrte an unseren Kleidern. Am liebsten hätten wir kehrtgemacht, doch im Haus war die „Hexe“, und keine von uns wäre jetzt da wieder hineingegangen. Also arbeiteten wir uns vor, bemüht, nicht von dem festgetretenen Pfad abzukommen. Aber wohin? Im Schneesturm erkannte man kaum ein Haus, auch sahen sie sich alle jetzt zum Verwechseln ähnlich. Wer weiß, wie lange wir noch herumgeirrt wären, wenn wir nicht plötzlich Kostja, den ältesten Sohn unserer Wirtin, getroffen hätten. Als er uns ins Haus brachte, war der Ofen schon von den beiden anderen Jungs, Walja und Pawlik, besetzt. Tante Njura scheuchte die beiden auf den Hängeboden und bedeutete uns: Hinauf mit euch!
Da saßen wir nun, die Russenjungen auf dem Hängeboden und wir deutschen Mädchen auf dem Ofen, und starrten uns an. Wir hätten etwas spielen können, aber wie, wenn wir uns doch gar nicht verständigen konnten? Einen Ausweg fand Pawlik. Er nahm ein Lehrbuch in die Hand und sagte: „Kniga.“ „Buch!“, schrie unser Trio zurück. Das wundersame Spiel, mit dessen Hilfe wir dann im Laufe nur weniger Monate Russisch gelernt haben, begann. Unsere „Russischlehrer“, die ihre Hausaufgaben übrigens auf diesem Wunderofen erledigten, lernten zwar kein Deutsch, aber der kleine Dorfjunge Pawlik begeisterte uns mit seiner Erfindung. Wir hatten schon alle möglichen Dinge benannt, doch bei den Küchenschaben blieben wir dann stecken. Keine von uns wusste, wie diese ekligen Viehcher hießen. „Schön, dann erzählen wir Märchen“, Klara kannte viele Märchen und konnte sie spannend erzählen. Doch schon bei „Hänsel und Gretel“ mussten wir aufgeben. Unsere neuen Freunde hatten zu wenig Deutsch gelernt, um das Märchen zu verstehen. Auch Walja scheiterte mit seinem russischen Märchen, wir schüttelten nur traurig die Köpfe und verloren immer mehr das Interesse an der Erzählung.
Hier werdet ihr auch verrecken
Inzwischen war es Abend geworden, und wir hatten kaum etwas gegessen. Zwar hatten wir noch ein bisschen Mehl übrig, aber Mama hatte ausdrücklich gesagt, ich sollte es für morgen aufheben. Sie wollte nach der Arbeit einige Kleider bei den Russinnen gegen Nahrungsmittel eintauschen. Aber Mama kam und kam nicht. Tante Njura hatte schon die Schafe und die Kuh versorgt, die Petroleumlampe angezündet und Essen auf den Tisch gestellt. Wir vergaßen unsere Märchen, denn in keinem gab es so viele essbare Dinge wie auf Tante Njuras Tisch: Milch, die den ganzen Tag in einem Tonkrug im Ofen gestanden hatte und deshalb mit einer goldbraunen Kruste bedeckt war, eine Menge Brot und eine Schüssel mit dampfender Kohlsuppe, die in der Küche ein betäubendes Aroma verbreitete!
Wir wussten, dass es sich nicht gehört, so unverschämt auf den Tisch zu starren, hatten aber, von Hunger geplagt, angesichts der Köstlichkeiten einfach nicht die Kraft, wegzusehen. Gebannt verfolgten wir jede Bewegung am Tisch, wie sich alle, als hörten sie auf ein Kommando, gleichzeitig bekreuzigten, langsam ihre Holzlöffel in die Hand nahmen, sie zu der in der Mitte stehenden Schüssel und gefüllt zurückführten, immer die dicke Scheibe Brot sorgfältig unter dem Löffel haltend. Die Verwunderung darüber, dass sie alle aus einer Schüssel aßen, war nur flüchtig. Ich führte meinen unsichtbaren Löffel mit, kaute, ja schmatzte, was ich sonst scheußlich fand. Ich war so vertieft in meine Betrachtung, dass ich nicht rechtzeitig wegschauen konnte, als Tante Njura, – durch die Stille auf dem Ofen aufmerksam geworden, – zu uns heraufsah.
Sie winkte uns herunter an den Tisch, wir jedoch bedankten uns, schüttelten die Köpfe: Nein, nein, wir haben keinen Hunger, überhaupt keinen! Doch unsere Hände arbeiteten sich schon hinunter, die Beine trugen uns zum Tisch, und die Augen verschlangen gierig alles, was darauf noch übriggeblieben war. Es kostete mich viel Mühe, den Blick von dieser Pracht loszureißen und Tante Njura fragend anzusehen.
Ihr schien etwas in die Augen gekommen zu sein, denn sie wischte dauernd mit ihrer Schürze daran herum.
Die Frau nahm ihren Söhnen die Löffel weg, denn im Haus gab es nur fünf davon, und schob die Schüssel näher an uns heran. Es war nicht mehr viel Suppe darin, aber wir wollten uns nicht wie arme Bettler darauf stürzen, und so führten wir unsere Löffel bedächtig zum Mund. Die Griffe der Holzlöffel waren rund, unbequem und boten keinen richtigen Halt, was aber am schlimmsten war: die Dinger waren viel zu groß und passten beim besten Willen nicht in den Mund. Wie sehr wir uns auch bemühten, es wollte und wollte nicht klappen, bis Tante Njura uns zeigte, dass man den Inhalt einfach seitlich in den Mund kippen musste. Wir machten es ihr dankbar nach, und schon bald kratzten wir die Kohl- und Kartoffelreste aus der Schüssel. Danach wurden die Löffel sorgfältig von innen und außen abgeleckt, und drei Augenpaare richteten sich erwartungsvoll auf Tante Njura.
Sie hatte auch schon drei Tontassen mit der schokoladengebräunten Milch gefüllt und reichte jeder von uns eine ganz dicke Scheibe Brot. Wir bemühten uns, langsam zu essen, um den Genuss in die Länge zu ziehen. Als wir dann vom Tisch aufstanden, satt und zufrieden, kam meine Mutter. Ich hatte sie zuerst gar nicht erkannt, diese vermummte, mit einer Schnee- und Eiskruste bedeckte Gestalt, die da an der Türschwelle stand. Sie sah Tante Njura mit einer Geste der Entschuldigung an und ging vorsichtig, damit keine Eisstücke von ihrer Kleidung auf den Boden fielen, in unser Zimmer. Ich lief ihr nach.
Mama versuchte verzweifelt, die an den Fußlappen festgefrorenen „Lapti“, selbstgeflochtene Bastschuhe, auszuziehen, aber ohne Erfolg. Auch die übrige Kleidung war ein einziger Eisklumpen, so dass wir warten mussten, bis sie etwas auftaute. Ich löste die Knoten des dicken Schals, den Mama um den Kopf gebunden hatte, und knöpfte die Steppjacke auf. Allmählich schälte sich Mama aus der grässlichen Kleidung.
Sie war schlecht gelaunt. Mürrisch zog sie ein Stückchen schwarzes, durch und durch gefrorenes Brot aus der Jackentasche:
„Hier, das ist alles, was ich heute verdient habe!“
Ich hielt das Brot in den Händen und schämte mich in Grund und Boden: Während ich auf dem warmen Ofen faulenzte, musste sich meine Mama in bitterer Kälte für dieses Stückchen Brot abschinden.
Читать дальше