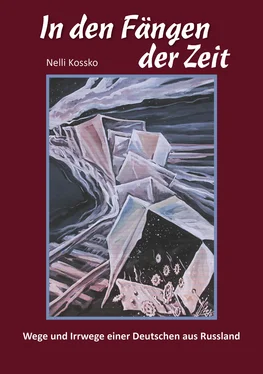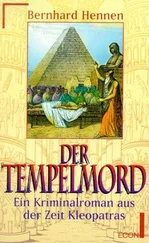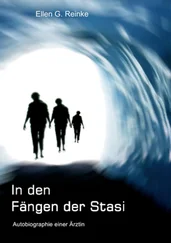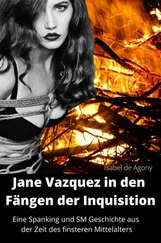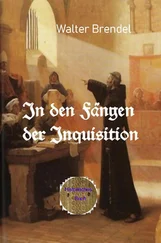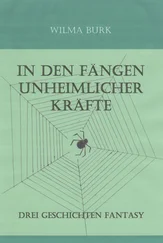Stückchen für Stückchen zuerst, dann aber mit voller Wucht stürzt die neue Welt auf uns ein – laut, schrill, grell und gleichgültig, ja, brutal. Es ist wie ein Schock. Soll etwa dieses so geschäftige, hektische, so laute und turbulente Durcheinander mit ihrem Glanz, den grellen Lichtern und Farben, diese Welt mit ihrer Anonymität das Land sein, das uns das Gefühl der Heimatlosigkeit nehmen soll? Ist dies das Deutschland, dessen Bild mir meine Mutter als eine Art Vermächtnis auf den Lebensweg mitgegeben hat?
Ein banges Gefühl beschleicht mich, und plötzlich kommt mir meine kleine Familie seltsam verloren in dieser so anderen Welt vor. Verloren und einsam.
„Ist eine Mark für eine Cola viel oder wenig?“, platzt Irene ganz unvermittelt in meine Gedanken. Ich schaue unseren Papa fragend an, aber auch er weiß auf diese eigentlich so banale Frage keine Antwort. Tja, was ist eigentlich eine Mark so wert?
Wir durften fast nichts bei der Ausreise mitnehmen außer einer Kiste Bücher und 90 Rubel pro Person, für die man uns in einer Bank in Moskau 300 Mark ausgezahlt hatte. Das ist nun unsere Barschaft, und so gesehen ist eine Mark in der Tat verdammt viel Geld. Ich will gerade den beiden Mädchen unsere finanzielle Situation erklären, doch da sehe ich, wie sie gebannt zum Kiosk hinüberstarren. Dort sind die herrlichsten Sachen zu bekommen, vor allem aber die begehrte Cola und die Kaugummis! Und so tätigen wir unseren erster Kauf auf deutschem Boden: zwei Dosen Cola und zwei Päckchen Kaugummi!
Im Bus, der uns ins Grenzdurchgangslager Friedland bringen soll, ist es still, die Insassen hängen ihren Gedanken nach. Die einen hadern mit der Vergangenheit, die anderen bangen der Zukunft entgegen.
„Sag mal“, mein Mann sieht mich prüfend von der Seite an, „wovor hast du vorhin so eine panische Angst gehabt? Hast du denn allen Ernstes geglaubt, man würde uns in Frankfurt nicht aussteigen lassen?“
Ich kann Alexander nicht verstehen, denn waren die nicht immer wortbrüchig? Entschieden sie nicht über unser Leben und Tod? Bis zur letzten Stunde? Früher … ach, lassen wir das!
Ich wende mich verstimmt ab, gebe aber noch zu bedenken:
„Wo wir doch gerade bei dem Thema sind: Damals, 1945, als sie uns in Viehwaggons verfrachteten und aus Dresden in die „Heimat“ zu bringen versprachen, wohin ging denn damals die Reise?“ Da Alexander schweigt, beantworte ich meine Frage selbst: „Genau, in Richtung Norden und Sibirien! Übrigens, wären wir heute in der DDR, in Dresden gelandet, hätte sich eigentlich der Kreis geschlossen!“
„Um Gottes willen!“ Alexander tut entsetzt, „was für eine grauenhafte Vorstellung!“
Ich stimme unwillkürlich in sein Lachen ein: Ein russischer Kommunist ist schon schlimm genug, aber der tüchtige Deutsche in dieser Rolle – Gott bewahre!
Wie ein Rettungsboot mit Schiffbrüchigen rast unser Bus durch die Nacht. Erschöpft von physischen und seelischen Strapazen sind unsere Mitreisenden, durchweg Russlanddeutsche, in einen kurzen, unruhigen Schlaf gesunken.
Ich kenne keinen von diesen unfreiwilligen Wanderern zwischen zwei Welten, die auch Jahrzehnte nach Kriegsende nicht zur Ruhe kommen können. Doch ich könnte, ohne dass mir schwere Fehler unterliefen, den Lebensweg der meisten skizzieren: Geboren in einer deutschen Kolonie im Süden der UdSSR, im Krieg als „Volksdeutsche“ ‚heim ins Reich’ geholt, nach Kriegsende von den Sowjets zurück verschleppt und wegen ‚Verrates an der sozialistischen Heimat’ zu lebenslänglicher Verbannung und Zwangsarbeit in den Wäldern Sibiriens, in den Minen des Ural und auf den Baumwollfeldern Zentralasiens verurteilt.
Ich war knappe neun Jahre alt, als man meine Mutter und mich aus Dresden in unseren Verbannungsort im Norden Russlands brachte, in ein Dorf in den Urwäldern des Kostromagebietes.
Kein Zug fährt in diese Gegend
Den ganzen Tag schon fuhren unsere Schlitten durch verschneite Felder und Wälder. Es war bitterkalt und ungewöhnlich still ringsum. Nur das monotone Knarren des Schnees unter den Pferdehufen und Schlittenkufen war zu hören und von Zeit zu Zeit noch die Stimmen der bewachenden Milizionäre, die die erschöpften Frauen und Vierbeiner zur Eile antrieben.
Mama hatte mich in unsere Wolldecken eingepackt, so dass ich nur die Augen frei hatte. Viel zu sehen bekam ich ohnehin nicht – nur die weiße eisige Einöde ringsum und den Rücken des Milizmannes auf dem Kutschbock. Ab und an stieg Mama vom Schlitten, um sich beim Laufen etwas zu erwärmen. Dann hörte ich sie mit den Frauen von den anderen Schlitten reden, mit denen wir schon ab Dresden in einem Zug gefahren waren. Auch sie versuchten durch Bewegung die Kälte aus ihren erstarrten Gliedern zu vertreiben. Wenn sie zu weit von unseren Schlitten zurückblieben, riefen die Milizionäre immer wieder:
„Hei, wy Njemzy, a nu dawaite, dawaite …“
„Mama, was will der denn von euch, und was heißt ‚Njemzy‘ überhaupt?“, wollte ich wissen.
„Auf Russisch heißt das Deutsche.“
Sie warf mir einen prüfenden Blick zu und fügte nach einer langen Pause hinzu:
„Du musst dich darauf gefasst machen, dass dieses Wort hier schlimmer klingt als ein Fluch. Aber da ist nichts zu machen, und du wirst dich daran gewöhnen müssen.“
Sie konnte nicht einmal ermessen, dass ihre Vorahnung harmlos war gegen all das, was uns in diesem Land erwartete.
Damals konnte ich Mamas Befürchtungen nicht begreifen. Man hatte uns immer anders genannt. In unserem Dorf Marienheim bei Odessa hießen wir „Schwarzmeerdeutsche“, in Possendorf bei Dresden nannte man uns oft „Russlanddeutsche“, und beim Streit in der Schule waren wir auch schon mal die „russischen Schweine“. Dabei konnte fast keiner von uns auch nur ein Wort Russisch! Als bei Kriegsende die Russen in Dresden einmarschierten, sprachen alle nur noch von „sowjetischen Bürgern“ und von der Rückkehr in die Heimat. Wir wurden in Viehwaggons verfrachtet und in den Norden Russlands gebracht. Als es mit dem Zug nicht mehr weiterging, mussten wir auf Schlitten umsteigen, die uns in unsere neue „Heimat“ bringen sollten.
Nun würden wir in diesem neuen Land eben einen neuen Namen bekommen, und warum sollte es nicht „Njemzy“ sein? Ich versuchte das Wort auszusprechen, aber es war verdammt schwierig. Ich werde noch meine liebe Not mit der russischen Sprache haben, dachte ich mir, verdrängte aber den unangenehmen Gedanken und versuchte mir vorzustellen, wie wohl die russischen Kinder aussehen mochten.
Gegen Abend trafen wir in einem kleinen verschneiten Dorf ein, dem Ziel unserer langen Reise. Die Schlitten blieben stehen, ein Milizmann verschwand in einer der Bauernkaten, und im Nu hatte sich eine Menge aus Frauen und Kindern um uns herum geschart. Für einen Augenblick verschlug es mir die Sprache: Die Russen waren gewöhnliche Menschen, ganz, ganz anders, als man uns in Deutschland in der Schule erzählt hatte. Blonde, blauäugige Frauen und Kinder standen um unseren Schlitten herum, lächelten freundlich, reckten die Hälse, stellten sich auf die Zehenspitzen, um uns besser betrachten zu können, und wiederholten immer wieder das Wort „Njemzy“. Auch sie, die zum ersten Mal leibhaftige Deutsche sahen, schienen genauso überrascht zu sein, denn sie redeten aufeinander ein, heftig gestikulierend und mit den Fingern auf uns deutend. Mir wurde unheimlich zumute. Was hatten die eigentlich vor? Warum sahen sie uns so verwundert an?
Mama konnte ein bisschen Russisch. Sie sagte, die Russen wunderten sich und seien sogar enttäuscht, dass wir so gewöhnlich aussehen, gar nicht wie die Feinde, von denen sie so viel gehört und gelesen hatten. Mir war kalt, ich hatte schrecklichen Hunger, die Menge jedoch machte keine Anstalten auseinanderzugehen.
Читать дальше