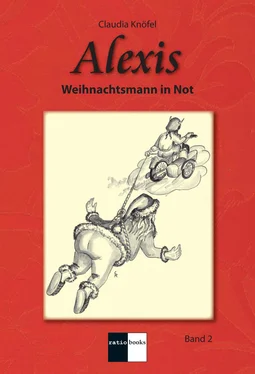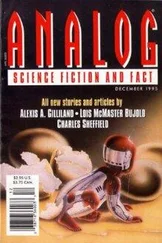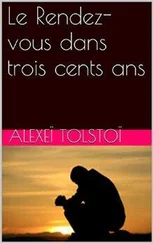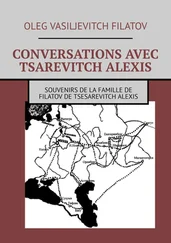Claudia Knöfel - Alexis Band 2
Здесь есть возможность читать онлайн «Claudia Knöfel - Alexis Band 2» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Alexis Band 2
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Alexis Band 2: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Alexis Band 2»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Unternehmen Sie mit dem Weihnachts(b)engel aufregende und vergnügliche Zeit-Reisen durch den Weihnachtshimmel, die himmlischen Backstuben und den Dörfern und Städten entlang des Rheins.
Alexis Band 2 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Alexis Band 2», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Jetzt, wo ich Mensch war, konnte ich es so oft und so laut sagen, wie ich wollte, ohne dass mir der Nikolaus die Flügel stutzte: „Merde, merde, merde!“ Das passte hundertprozentig. Denn nachdem die Dame ihren Gatten gerufen hatte, ein stämmiger Herr übrigens, mit dem ich ungern meine Kräfte gemessen hätte, forderte dieser umgehend die Bezahlung des üppigen Mahls, das ich genossen hatte. Ich war nicht gewillt, meinen bescheidenen Bestand an Bargeld herauszurücken, und so beschloss die Familie einstimmig – mittlerweile waren noch zwei Schulbuben und ein greiser Herr ohne Zähne angerückt – dass ich mir mein Essen verdienen sollte.
So kam es, dass ich eine Betätigung verrichten durfte, deren Arbeitsablauf ich nur zu gut kannte: Stallausmisten. Nur, dass es sich hier nicht um himmlische Rentierexkremente handelte, sondern um weitaus intensiver duftenden Kuhmist. Und das unter der scharfen Bewachung des zahnlosen Alten, der auf einer Bank vor dem Kuhstall saß und eine Mistgabel im Anschlag hielt. Da ich nicht die geringste Lust hatte, den schönen Tag in dieser stinkenden Umgebung zu vergeuden, griff ich zu einer List. Ich ließ die Forke fallen und legte in einer dramatischen Geste die Hand auf mein Herz. Dann sank ich röchelnd zu Boden. Der Greis kam in den Stall, besah sich die Lage – und ging zur Stallwand, wo Eimer standen. Alsdann goss er mir einen Kübel eiskalten Wassers ins Gesicht. Das reichte! Ich sprang auf, packte den Greis und hob ihn über die Absperrung in die Futterrinne. Dann gab ich Fersengeld und rannte, von den bellenden Hunden gefolgt, davon. Als ich endlich im Tal angekommen war, sah ich reichlich lädiert aus. Die Kleidung war zerrissen und schmutzig. Überall an meinem Körper fühlte ich Stacheln. Denn die einzige Möglichkeit, die ich gesehen hatte, den geifernden Bestien zu entkommen, war die, in ein Brombeergestrüpp zu hechten. Ich war völlig fertig.

Soviel sportlichen Ehrgeiz hatte ich nicht mehr entwickelt, seitdem der Graf d‘Anjou mich im Jahre 1640 in flagranti bei seiner Gattin entdeckt hatte. Damals flüchtete ich über den Balkon der Pariser Stadtvilla, der vier Stockwerke über der Rue de Bourbon lag. Ein nervenaufreibendes Unterfangen, wie ich Ihnen versichere. Denn während ich mich zur winterlichen Mittagsstunde völlig bar jeder Kleidung an den Vorsprüngen des Gebäudes entlanghangelte und die Schwindel erregende Aussicht genoss, sann über mir der gekränkte Graf mit einer Muskete ballernd auf Rache. Wie durch ein Wunder erreichte ich den Boden zwar körperlich einigermaßen intakt, aber mittlerweile hatte sich eine Menschenmenge gebildet, die sich in zwei Fraktionen spaltete: einmal in die, die mich bei meiner Klettertour anfeuerte, und eine andere, die den düpierten Graf lauthals unterstützte. Und, wie gesagt, ich war völlig nackt. Ich erinnere mich, dass ich mir von einem Karren eine überaus schmutzige Decke griff, die ich hastig um mich schlang, bevor ich mich eilenden Schrittes entfernte, verfolgt von rohem Gelächter.
Doch zurück zu meinem heutigen Abenteuer. Mehr tot als lebendig erreichte ich schließlich ein kleines Dorf. Zu meiner Freude bemerkte ich, dass an den Straßen Säcke mit Altkleidern standen. Schnell waren eine passable Jeans und ein Pullover gewählt und dann ging ich in eine kleine Kirche, in der ich meine neuen Kleidungsstücke anprobierte. Sie passten perfekt. Anschließend marschierte ich zur Hauptstraße, wo ich nach Sitte der Tramper den Daumen ausstreckte und so auf einen gütigen Autofahrer hoffte, der mich mitnahm.
Sechs Monate später saß ich im traditionsreichen Spielkasino von Monaco, vor mir lag ein ansehnliches Häuflein Jetons. „ Rien ne va plus!“ , rief der Croupier. Die Kugel rollte. Dann ein Klackern. „ Neuf! “ Mein amerikanischer Tischnachbar atmete zischend aus. Mit zitternden Händen holte er seine Geldbörse aus der Hosentasche und warf dem Croupier mit vorgetäuschter Lässigkeit ein paar Dollarscheine über den Tisch. Viel war es nicht, was er gegen das bunte Plastikgeld eintauschte. Der Mann hatte wirklich eine ausgesprochene Pechsträhne. Ich dagegen hatte Glück. Nein, das war es eigentlich nicht. Es war Können. Ich beherrschte ein bestimmtes System für das Roulette bis zur Perfektion, jedenfalls schien das so. Max, der hinter mir stand, flüsterte mir diskret ins Ohr: „ Monsieur le Baron , Sie sollten das Spiel beenden. Die Direktion ist ausgesprochen misstrauisch!“ Das stimmte. Zwei unauffällige Männer in dunklen Anzügen, wahrscheinlich Security-Leute, hatten sich auf die mir gegenüberliegende Seite gestellt und beobachteten die Vorgänge am Tisch. Die Situation wurde langsam brenzlig. Ich beschloss, die „Glückssträhne“ zu unterbrechen, und setzte fünfhundert Euro auf die Dreißig. Der Croupier warf die Kugel in den Kessel. „ Rien ne va plus !“ Und dann : „ Zero !“ Der Amerikaner neben mir stöhnte, schnappte sich den verbliebenen Jeton und stand auf. Sofort war der Platz wieder besetzt. „Sie sollten noch drei, vier Mal setzen und dann versuchen zu verschwinden. Ich lenke von Ihnen ab!“ Wenn Max das sagte, dann konnte ich mich darauf verlassen, dass es so die beste Lösung war. Auch wenn mir die Entscheidung nicht leicht fiel, ich beschloss, in den nächsten Minuten achtzig Prozent meines Plastikgeldes zu verlieren.
Ich vertraute Max bedingungslos. Er war mein Ratgeber, mein Kammerdiener, Finanzminister und Privatsekretär. Nebenbei war er auch Mathematik-Professor und hatte sich dieses geniale Roulette-System ausgerechnet, mit dem es möglich war, jede Spielbank zu knacken.
Damals, an jenem Frühlingstag in den Südtiroler Alpen, hatte ich ihn kennengelernt. Nachdem ich mich neu eingekleidet hatte, war ich nach Meran getrampt. Zunächst nährte ich noch die Hoffnung, ich würde meine himmlischen compagnons unterwegs treffen. Doch je weiter sich der Tag seinem Ende zuneigte, desto mehr wuchs in mir die Gewissheit, dass ich meine Freunde so schnell nicht wiedersehen würde. Mein Magen war mittlerweile wieder ziemlich leer. Also beschloss ich, das mir verbliebene Startkapital von 1,20 EUR gewinnbringend einzusetzen, organisierte mir in einer Eisdiele drei Pappbecher und eine Kaffeebohne und verschwand zum Training in einen Hinterhof.
Als meine Finger wieder die Geschmeidigkeit früherer Jahrhunderte erreicht hatten, setzte ich mich in die Fußgängerzone, um die Passanten zum „Hütchen-Spiel“ einzuladen. Damit hatte ich bereits zu Richelieus Zeiten neben einigen anderen „Fingerfertigkeiten“ meinen Lebensunterhalt finanziert. Und auch diesmal merkte ich: Die Idioten sterben nicht aus. In kürzester Zeit hatte sich ein ansehnliches Häuflein Münzen vor mir angesammelt. Sie kennen sicher das Spiel: Unter einem der „Hütchen“, also in diesem Fall einem Becher, liegt die Kaffeebohne, der „Bankhalter“ vertauscht sehr rasch die Behältnisse, und der Herausforderer muss raten, unter welchem die Bohne liegt. Das sieht alles sehr einfach und einleuchtend aus, aber es ist ein Trick dabei, den ich natürlich nicht verraten werde, denn der Bankhalter gewinnt zu 99,99%, weshalb das Spiel auch in einigen Ländern verboten ist. Aber wie gesagt, das Interesse der Passanten war groß. Während ich gekonnt mit den Pappbechern jonglierte, beobachtete ich aus den Augenwinkeln einen heruntergekommenen Herrn mittleren Alters, der seinerseits meine Darbietung interessiert verfolgte. Ich war leicht beunruhigt. Was wollte der Typ von mir?
Mittlerweile war es Abend geworden, und so packte ich mein Zeug zusammen. Ich beschloss, mir endlich von meinem Gewinn eine Pizza und eine Flasche Chianti zu gönnen. „Ein Spiel noch?“, hörte ich plötzlich neben mir eine Stimme. Ich blickte auf und erkannte den Mann, der mich seit Stunden beobachtet hatte. Ein Polizist in Zivil? „Okay. Fünfzig Cent ist der Einsatz“, hörte ich mich sagen. Der Mann nickte. „Ich weiß.“ Also packte ich die Becher wieder aus. Um es kurz zu machen: In der nächsten halben Stunde verlor ich meine gesamte Tageseinnahme an den Fremden. Die Pizza entschwand in weiter Ferne. „Was halten Sie von einem guten Abendessen?“, fragte mein Herausforderer. „Scherzkeks!“, schnaubte ich verächtlich. Der Mann grinste. „Sie sind natürlich mein Gast!“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Alexis Band 2»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Alexis Band 2» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Alexis Band 2» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.