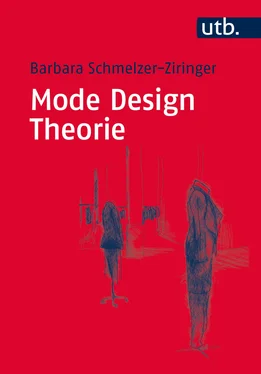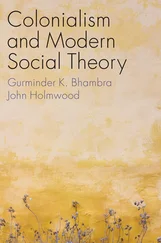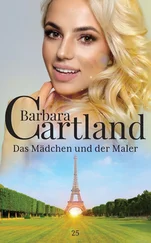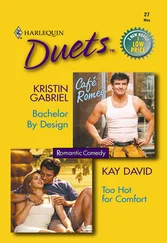Barbara Schmelzer-Ziringer - Mode Design Theorie
Здесь есть возможность читать онлайн «Barbara Schmelzer-Ziringer - Mode Design Theorie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mode Design Theorie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mode Design Theorie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mode Design Theorie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mode Design Theorie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mode Design Theorie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
58Vgl. Schneider 2005, S. 113f.
59Vgl. Bürdek 1991, S. 43ff.
60Vgl. Schneider 2005, S. 165.
61Vgl. Walker 1992, S. 36.
62Legendär sind Dieter Rams’ zehn Thesen zum Design aus den 1970er-Jahren. Weniger bekannt dagegen ist sein Tokio-Manifest von 2009, in dem er sich zu einem Design bekennt, das den „Schutz der natürlichen Umwelt und Überwindung des gedankenlosen Konsums“ als Herausforderungen annimmt. Vgl. Rams 2009, S. 502 und Borries 2013, S. 24; Schneider 2005, S. 113.
63Zur diesbezüglichen Entwicklung in Deutschland vgl. Grundmeier 2005, S. 230–235.
64Vgl. Frenzl 2009, S. 126.
65Mareis 2011, S. 235f.
66Sennett betonte dahin gehend die ökonomische Beziehung zwischen Auftraggeber und Künstlerpersönlichkeit. Vgl. Sennett 2008, S. 100ff.
67Angela McRobbie hat in den späten 1980er-Jahren eine hervorragende Studie zum beruflichen Umfeld junger Modedesigner/innen vorgelegt, die mit Street-Culture-Elementen arbeiteten, und in diesem Kontext den neoliberal implementierten Charakter der Creative Industries in Großbritannien untersucht. Vgl. McRobbie 1998.
68Zu den Implikationen einer „absoluten Neuschöpfung“ vgl. Mareis 2011, S. 237f.
69Zur Situation in Großbritannien vgl. beispielsweise Redhead 2011, S. 32ff.
70Voßmerbäumer, Bernd in Art Position, Sonderheft Design, 20. August 1990 zitiert nach Bürdek 1991, S. 68.
71Ebd.
72Bürdek 1991, S. 54.
73Dick Hebdige hat im Gegensatz zum ‚Styling‘ das Potenzial des ‚Styles‘ im Kontext subkultureller Stilentwicklungen herausgearbeitet und dabei die symbolische Funktion von Bekleidung als soziales Phänomen hervorgehoben. Vgl. Walker 1992, S. 192; Hebdige 1988 und des Weiteren Godart 2012, S. 66–71.
74Reckwitz 2012, S. 171.
75Zu Michel Foucaults Konzept des Dispositivs kommentiert Reckwitz: „Ein Dispositiv bildet keine bloße Institution, kein abgeschlossenes Funktionssystem, kein Wert- und Normmuster und mehr als einen Diskurs. Es umfasst ein ganzes soziales Netzwerk von gesellschaftlich verstreuten Praktiken, Diskursen, Artefaktsystemen und Subjektivierungsweisen, die nicht völlig homogen, aber doch identifizierbar durch bestimmte Wissensordnungen koordiniert werden.“ Reckwitz 2012, S. 49. Zum Begriff des Dispositivs siehe des Weiteren Abschnitt 2.5in diesem Band.
76Reckwitz 2012, S. 53.
77Zum Begriff „Wirtschaftsästhetik“ vgl. Biehl-Missal 2011.
78Reckwitz 2012, S. 15.
79Ebd., S. 164f.
80Vgl. Stone 2010. S. 296–297.
81Vgl. Briggs 2013, S. 187f.
82Vgl. u. a. Atkinson 2012, S. 94. Boeck 2011, S. 12–17; Brown 2010, S. 9; Dillon 2012; Hermanns/Schmitt/Wißmeier 1991; Jenkyn Jones 2006, S. 56–76; Meadows 2013, S. 78–111.
83Vgl. Boeck 2011, S. 233, S. 239, S. 275, S. 289, S. 314, S. 316.
84Vgl. McRobbie 2000, S. 253f.; Redhead 2011, S. 28.
85Grasskamp 1992, S. 158.
86Vgl. dazu die Modewochenkalender in Atkinson 2012, S. 34 und San Martin 2010, S. 174.
87Vgl. beispielsweise im Kontext kulturwissenschaftlicher Forschungsschwerpunke, Arnold 2001; Barnard 2007; Bieger/Reich/Rohr 2012; Bippus/Mink 2007; Bruzzi/Church Gibson 2000, 2013; Craik 2000, 2009; Geiger 2008; Holenstein et al. 2010; Kaiser 2012; Lehnert 2013; McNeil 2009, 2009a, 2009b, 2009c; McRobbie 1999. Und bezüglich des Nexus Mode und Kunst sowie seiner Musealisierung Breward/Clark 2014; Brüderlin/Lütgens 2011; Clark/de la Haye 2014; Geczy/Karaminas 2013; Kubler/Oakley Smith 2013; Lehnert 2006; Lüddemann 2007, S. 182ff.; Mackrell 2005; Melchior/Svensson 2014; Müller 2000; Neuburger/Rüdiger 2012; Pape 2008 u. v. a. m., die in diesem Band Erwähnung finden.
88Vgl. zu Methoden und Forschungsansätzen beispielsweise Brandes/Erlhoff/Schemmann 2009, S. 62–193; Bürdek 1991, S. 158–177; Cross 2007, S. 99–116; Cross 2011, S. 133–149; Schneider 2005, S. 283–288.
89Bonsiepe, Gui: Arabesken der Rationalität/Anmerkungen zur Methodologie des Designs. ulmer texte 19/20, 1967. S. 49/50. URL: http://ulmertexte.kisd.de/fileadmin/pdf/Arabesken_CB_prt.pdf(20. 10. 2014).
90Ebd.
91Vgl. ebd.
92Vgl. dazu den Band Weil Design die Welt verändert… Texte zur Gestaltung von Borries/Fezer 2013.
93Vgl. dazu Karafyllis 2003.
94Vgl. Grundmeier 2005, S. 236f.; Anand et al. 2006.
95Michael Erlhoff betont dagegen die „Qualität der Unschärfe“ von Design im Gegensatz zur Wissenschaft. Vgl. Erlhoff 2010, S. 37–41.
96Vgl. Brandes 1998, S. 83.
97Vgl. die einseitigen Darstellungen von techno fashion, welche die Zukunft bestimmen soll in Quinn 2002, S. 1f. und des Weiteren Lee 2005; Quinn 2010, 2012; Seymour 2008, 2010.
98Vgl. zu Mart Stam Abschnitt 1.1in diesem Band.
99Vgl. Brandes/Erlhoff/Schemmann 2009, S. 23f. und Mareis 2011, S. 27ff.
100Vgl. Walker 1992, S. 44 und des Weiteren Papanek 2009, S. 17.
101Mareis 2011, S. 391.
102Vgl. ebd., S. 393.
103Mareis 2010, S. 92.
104Vgl. ebd., S. 93.
105Ebd., S. 94.
106Vgl. Mareis 2011, S. 64ff.
107Vgl. des Weiteren die konkrete Rezeption der drei Typologien in Schneider 2005, S. 273–276.
108Vgl. Mareis 2011, S. 65f.
109Vgl. ebd. S. 66.
110Vgl. ebd.
111Vgl. ebd., S. 240.
112Zur Stellenwert von implizitem und explizitem Wissen in der kreativen Praxis nach Michael Polanyi vgl. Lehnert 2013, S. 33f.; Mareis 2011, S. 247–277 und Polanyi 1985.
113Vgl. Cross 2013; Cross 2007.
114Mareis 2011, S. 399.
115Der Terminus „Wahrheitsspiele“ verweist bei Foucault auf eine „Regelmenge zur Herstellung der Wahrheit“ und gleichzeitig auf die „Menge von Verfahren, die zu einem bestimmten Ergebnis führen, das nach Maßgabe seiner Verfahrensregeln und -prinzipien als gültig oder nicht, als Sieger oder als Verlierer betrachtet werden kann.“ Foucault 1993, S. 24.
116Vgl. zur „Semantik von ,Designwissen‘“ Mareis 2011, S. 177–191.
117Vgl. Bonsiepe 2009, S. 177.
118Ebd.
119Vgl. ebd., S. 31.
120Spivak 1990, S. 2.
121Vgl. Bonsiepe 2009, S. 15f.
122Vgl. ebd., S. 15.
123Vgl. Loos 2000, S. 51–57; S. 120–134.
124Vgl. Rotermund 2012, S. 99f. und zur Darstellung von John Ruskin und William Morris als Protagonisten des Arts and Crafts Movement siehe Brandes/Erlhoff/Schemmann 2009, S. 39–41. Zu Gottfried Sempers Einschätzung des Textilen als Urform der Architektur siehe Harather 1995, S. 12–20.
125Rotermund 2012, S. 100.
126Zu den globalen Hybridformen westlicher und nichtwestlicher Kleidung vgl. u. a. Maynard 2004.
127Vgl. Bürdek 1991, S. 23.
128Vgl. Bohnsack 1981, S. 177–183.
129Zur Kritiktradition an der ,Mode‘ als ‚weibliche Vanitas‘ vgl. Wolter 2002, S. 30–36.
130Vgl. Wolter 1994, S. 82–89.
131Vgl. Wilson 1989, S. 222.
132Vgl. Wilson 1989, S. 223–225; Wolter 1994, S. 48–56.
133Zu den frühsozialistischen Wurzeln des Bloomerism in den Vereinigten Staaten vgl. Luck 1992.
134Vgl. Ober 2005, S. 154ff.
135Vgl. Ober 2005, S. 23f.; Wilson 1989, S. 228.
136Vgl. Ober 2005, S. 144–145.
137Ebd., S. 145.
138Vgl. ebd., S. 102.
139Ebd.
140Ingrid Loschek vermerkte dazu, dass die Erfindung der Stahlreifenkrinoline u. a. W. S. Thomson zugeschrieben werde, der mehrere große Fabriken betrieb. Vgl. Loschek 2005, S. 343.
141Fuchs 1986, S. 175.
142Doris Kolesch sprach von einer schwierigen Beziehung zwischen Mode, Moderne und Kulturtheorie, die davon bestimmt wäre, dass die Mode weiblich sei. Vgl. Kolesch 1998, S. 20ff.
143Zur Reformkleidung und den damit verbundenen sozialen Utopien vgl. Wilson 1989, S. 222–241 und zu Bekleidungsutopien im Allgemeinen siehe Ribeiro 1992, S. 225–237.
144Zu den Begriffen der Invention und Innovation im textilen Zusammenhang siehe Barbe 2012, S. 27ff.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mode Design Theorie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mode Design Theorie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mode Design Theorie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.