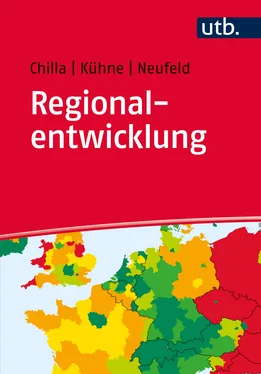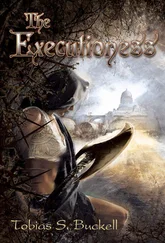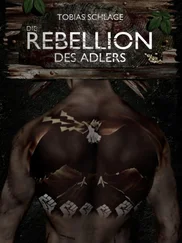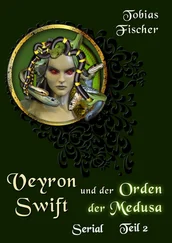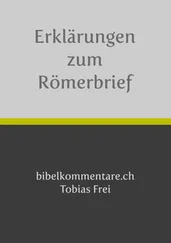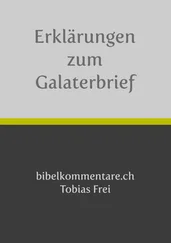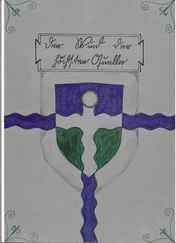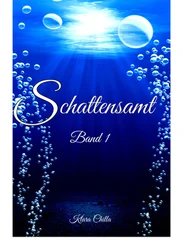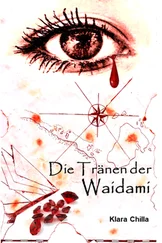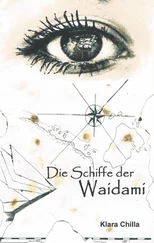Die positivistisch orientierte Forschung ist sich durchaus bewusst, dass die Forschungsergebnisse als Abstraktionen bestimmten Setzungen folgen, insbesondere den Entscheidungen darüber, was als relevant für die ‚Region‘ gilt und was nicht. Gemäß dieser Vorstellung ist Raum „eine Art Behältnis, in das man etwas hinein tun kann und [das] mit Objekten ausgestattet (möbliert) ist“ (Egner 2010: 98). In dieses Behältnis des ‚bewusstseinsunabhängigen Raumes‘ wird das, was als Region verstanden wird, ‚eingehängt‘. Die Abgrenzung dieser Region basiert – wie beschrieben – auf der Auswertung beobachteter Phänomene. Die Ergebnisse positivistischer Regionalforschung sind in der Regel stärker analytisch als normativ. Normative Aussagen werden in der Regel nicht auf die ‚Totalität‘ der Region bezogen, wie dies bei einem essentialistischen Verständnis für die normative Erhaltung ‚der historisch gewachsenen Kulturlandschaft‘ der Fall ist. Allerdings können Erkenntnisse auf der einen Ebene Aussagen für andere Ebenen nach sich ziehen. So kann die Feststellung, eine bestimmte geschützte Tier- oder Pflanzenart nehme in ihrem Bestand rapide ab, normative Aussagen in Bezug auf die Bewirtschaftung von Flächen nach sich ziehen. Konflikte zwischen Alternativen, z. B. dem Bau einer Autobahn gegen die Ansprüche des Artenschutzes, lassen sich durch die Betrachtung und Bewertung der einzelnen Ebenen im Kontext anderer Ebenen abwägen (z. B. Schmale 1994). Ein solches Abwägen ist dem Essentialismus fremd, da jeder Eingriff, der das Nicht-Autochthone repräsentiert, als Bedrohung des Wesens der historisch gewachsenen Kulturlandschaft verstanden wird.
Positivistische Regionalforschung weist ein eher sachliches Verhältnis zu den Bewohnern bzw. Nutzern einer Region auf, eine moralische Erwartung an das Handeln (wie im Essentialismus) erfolgt in der Regel nicht. Nutzungseinschränkungen werden auf Grundlage empirischer Befunde unter Verweis auf rechtliche Regelungen formuliert (Burckhardt 2006, Kühne 2008).
Im Bereich der angewandten Geographie, der Planungsprozesse und der Raumbeobachtung liegt die positivistische Perspektive auch heute dominant zugrunde. Bei Planungsvorhaben auf allen Ebenen sind häufig analytische Schritte vorgesehen, bei denen typischerweise anhand ausgewählter Indikatoren eine Raumcharakteristik erstellt wird, die Positionierung des Raumes im weiteren Umfeld erläutert und wichtige Entwicklungstrends formuliert sind. Regionalpläne, Flächennutzungspläne usw. fußen in der Regel auf diesen Ansätzen. Ein solches analytisches Fundament ist zweifellos auch sinnvoll, allerdings ist vor dem Trugschluss zu warnen, dass eine indikatorengestützte Analyse wirklich objektiv sein kann. Bereits die Wahl des Indikators und die Verfügbarkeit von Daten bedingt Limitierungen in der Analyse. Beispielsweise stehen im grenznahen Raum kaum Daten zur Verfügung, die eine kleinräumige, grenzüberschreitende Verflechtungsanalyse erlauben – meist sind großräumige Pendlerzahlen und Verkehrsflüsse an den Hauptverkehrsadern schon das Aussagekräftigste, was verfügbar gemacht werden kann. Wirtschaftsverflechtungen, kleinräumige Migrationen und Erreichbarkeiten hingegen sind im Grenzraum allenfalls punktuell darstellbar – dies hat für spätere Planungsvorhaben durchaus Konsequenzen, weil beispielsweise kleinräumige Phänomene nicht abgebildet wurden. Diese Gefahren bringt die Bezeichnung „data driven research“ zum Ausdruck.
Dennoch ist bei allen Risiken das Potenzial der indikatorengestützten Raumanalyse nicht zu unterschätzen. Zwei Entwicklungen haben in den vergangenen Jahren wichtige Impulse gegeben:
Zum einen hat die europaweite Harmonisierung von Daten den Horizont stark erweitert. Diese Entwicklung war eng verbunden mit der Debatte um ein „evidence based planning“ sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene (s. das Themenheft von Faludi & Waterhout 2006): In einem etwas euphorischen Diskurs wurde diskutiert, dass Raumentwicklung weniger mittels langwieriger politischer Auseinandersetzungen entschieden oder gar dem Zufall überlassen werden sollte, sondern mittels indikatorengestützter Raumbeobachtung auf eher technische Art gestaltet werden sollte. Nachdem eine europäische Planungskompetenz nicht etabliert werden konnte, ist diese Diskussion inzwischen etwas abgekühlt. Allerdings wird die Nutzbarkeit europäischer Daten in Zukunft eine immer größere Rolle spielen können: Die sogenannte INSPIRE-Richtlinie der Europäischen Union von 2007 verpflichtet die Mitgliedsstaaten zunächst zur Harmonisierung von Geodaten (also der raumbezogenen Darstellung mit ihren Koordinaten und Projektionen), aber auch die Harmonisierung von Fachdaten (insbesondere im Umweltbereich) ist hier festgeschrieben. Insbesondere für Grenzräume ergeben sich hieraus große Potenziale, da hier bislang oft nicht kompatible Datensysteme aneinander grenzten.
Zum zweiten verspricht die aktuelle ‚Datenrevolution‘ auf allen Ebenen ganz neue Möglichkeiten. Durch die Digitalisierung vieler Lebensbereiche entstehen neue Datenarten und -mengen, was unter dem Begriff „big spatial data“ diskutiert wird (Graham & Shelton 2013, Kitchin 2013). Smartphones, Navigationsgeräte und die Nutzung von Social Media etc. lassen permanent neue Daten entstehen, deren Nutzung für Raumanalysen und -planungen erst noch bevorstehen. Deren Nutzung bietet neue Möglichkeiten, zugleich aber auch ein gewisses Risiko für die individuelle Privatsphäre.
1.3.3Konstruktivistische Ansätze
Während das essenzialistische Verständnis davon ausgeht, eine Region habe ein nicht unmittelbar erfassbares ‚Wesen‘ und das positivistische Verständnis postuliert, es gäbe einen ‚realen‘ Raum, der sich auf Grundlage empirischer Messung von unterschiedlichen Merkmalen regionalisieren lässt, so haben konstruktivistische Ansätze einen gänzlich anderen Ausgangspunkt: Aus dieser Perspektive sind Regionen das Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Demnach ist eine Region nicht, sie wird vielmehr gemacht. Die Beschreibung ‚Region‘ wird damit zu dem Ergebnis von Sinn- und Bedeutungszuschreibungen (Burr 2003, Werlen 2007, Kühne 2013). Diese beziehen sich entweder auf die alltäglichen Logiken des Handelns oder von Systemen, wie zum Beispiel den institutionalisierten Prozessen der Planung. Was von wem als Region bezeichnet wird, hat also nichts mit einem ‚Wesen‘ zu tun und ist auch nicht mit objektiven Indikatoren herzuleiten, sondern basiert darauf, was Menschen als Region bezeichnen. Infolge gesellschaftlicher Konventionen sind wir nicht daran gewöhnt, Region als Prozess (also konstruktivistisch), sondern als Gegenstand zu verstehen, sie erscheint „uns nicht als soziale Konstruktion, sondern als Wirklichkeit“ (Ipsen 2006: 31).
Das Erkenntnisinteresse konstruktivistischer Regionalforschung bezieht sich also nicht auf die Frage, welche essentiellen Eigenschaften eine Region habe (essenzialistische Perspektive). Ebenso wenig wird die Frage gestellt, welche Strukturen und Funktionen in welcher von anderen Räumen unterscheidbarer Konstellationen zu finden seien (positivistische Perspektive). Vielmehr ist konstruktivistische Regionalforschung auf Fragen bezogen wie:
Welche Kriterien werden zur Abgrenzung von Regionen sozial akzeptiert ?
Wem wird die Kompetenz zugeschrieben, Regionen abzugrenzen ?
Welche Bedeutungen werden einer – wie auch immer definierten – Region zugeschrieben ?
Wie werden räumliche Ab- und Ausgrenzungsprozesse durch die Definition von Regionen begründet ?
Wem nützt welche Form der Regionalisierung, wer befürchtet Nachteile ?
Im Fokus der konstruktivistischen Perspektive steht also besonders der Prozess (Regionalisierung), weniger das Ergebnis (Region). Wenn im Zuge von Grenzliberalisierungen neue Räume entstehen, wenn in Deutschland Metropolregionen eingeführt werden oder wenn auf europäischer Ebene Makroregionen implementiert werden – immer dann lassen sich Prozesse der (Neu-)Regionalisierung untersuchen. Das oben diskutierte Fallbeispiel der Makroregion Alpen (EUSALP) ist hierfür ein typisches Beispiel.
Читать дальше