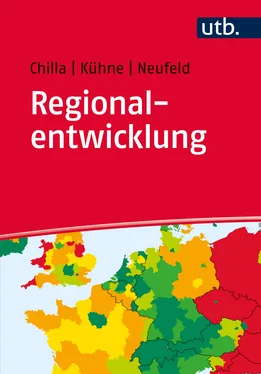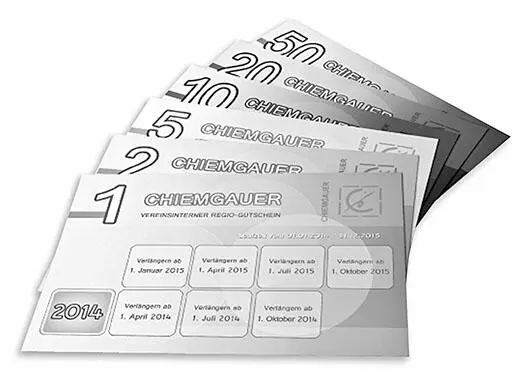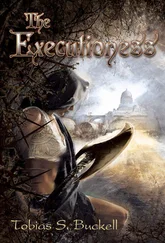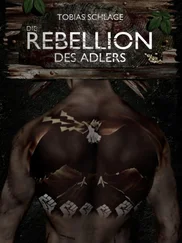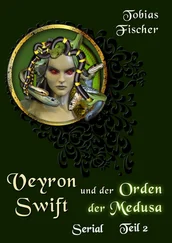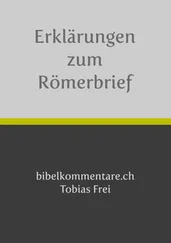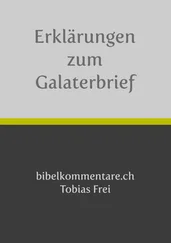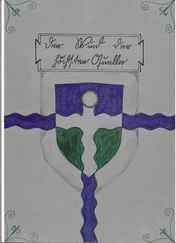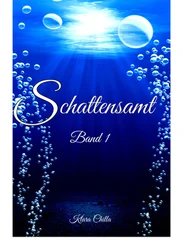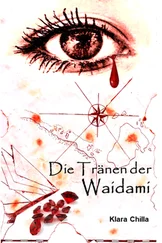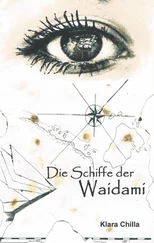Beispiel: Chiemgauer – regionale Währung
Der Chiemgauer entstand 2003 aus einem Schülerprojekt an der Freien Waldorfschule in Prien am Chiemsee und ist heute die erfolgreichste Regionalwährung in Deutschland mit knapp 3900 registrierten Mitgliedern (Verbraucher, Unternehmen, Vereine) und einem Chiemgauer-Umsatz aller Unternehmen von fast 7,5 Mio. Euro im Jahr 2014. Seit Beginn des Projekts steigen die Umsätze jährlich, mittlerweile wird das Projekt durch den Verein Chiemgauer e. V. und die Genossenschaft Regios eG organisiert und abgewickelt. Die Grundidee von Regionalwährungen ist es, Geld oder Dienstleistungen in eine regionale Währung zu tauschen, um damit regionale Wertschöpfung zu stärken.
Der Chiemgauer ist eine Währung, mit der in den Landkreisen Rosenheim und Traunstein bezahlt werden kann (Tauschverhältnis 1 : 1). Um als Verbraucher teilzunehmen, kann man sich kostenlos registrieren und bekommt eine ‚Regiocard‘ für elektronische Zahlungen, man kann den Chiemgauer aber auch abheben und in bar bezahlen. Abgehobene Chiemgauer sind allerdings nur einige Monate gültig, dadurch soll ein stetiger und schneller Umlauf bewirkt werden. Die Chiemgauer sind in den registrierten regionalen Unternehmen einsetzbar.
Beim Umtausch in Euro werden 5 % des Betrages einbehalten, mit denen örtliche Vereine und die Organisation der Währung finanziert werden (Sport-, Musik-, Trachtenvereine etc.) (Wieg 2009, Chiemgauer Regiogeld UG o. J.).
Das Beispiel verdeutlicht anschaulich, wie private Akteure aktiv in der Regionalentwicklung agieren und diese beeinflussen können.
Weitere Informationen: www.chiemgauer.info
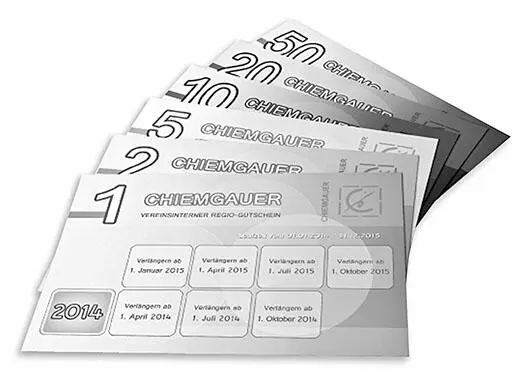
Abb. 12 Der Chiemgauer (Quelle: Chiemgauer Regiogeld UG)
Auf der Schnittstelle zwischen unternehmerischem und regionalem Handeln ist das Schaffen von Infrastrukturen zu sehen. Waren früher Werkssiedlungen fester Bestandteil vieler Industriestädte, so werden heute Städte und Stadtteile häufig im umfassenden Sinne von einzelnen Unternehmen geprägt. In Deutschland ist dies vor allem in den kleinen Großstädten mit wichtigen Arbeitgebern sichtbar: Wolfsburg hat mit seiner gläsernen Fabrik von Volkswagen de facto ein zweites Stadtzentrum bekommen, in Erlangen entsteht derzeit mit dem Siemens-Campus in unmittelbarer Nähe zur Altstadt ein neuer Stadtteil, und in Ingolstadt nimmt der Audi-Konzern aktiv Stellung in der lokalen Verkehrspolitik.
Auch die Bevölkerung ist mitnichten nur als Adressat von regionaler Entwicklung anzusehen, sondern als wesentlicher Akteur. Wohnstandortwahl, Mobilitäts- und Einkaufsverhalten, aber auch ehrenamtliches Engagement auf individueller Ebene sind ganz wesentliche Parameter für regionale Entwicklung. Und auch in diesem Bereich sind eine ganze Reihe Ansätze explizit aus der Regionalentwicklung zu erkennen: Dies umfasst zu einem erheblichen Anteil Gegen- und Protestbewegungen (gegen Atom- oder Windkraft, für oder gegen Umgehungsstraßen etc., s. Kap. 3.3). Hinzu kommen zahlreiche Initiativen der alternativen Regionalentwicklung – z. B. Genossenschaften der Windenergie zur regionalen Verankerung der Wertschöpfung oder Etablierung von regionalen Währungen.
Wenn von Akteuren der Regionalentwicklung die Rede ist, so meint dies letztlich individuelles Handeln durch Einzelpersonen, sei es der Beamte des Bauamtes, der eine Genehmigung erteilt, oder die Fachkraft, die eine Mobilitätsentscheidung trifft. In der Reflexion und in der Steuerung von Regionalentwicklung ist diese Mikroperspektive aber selten hilfreich, da es in aller Regel um Akteursgruppen und auch um Strukturen geht. So war soeben die Rede von staatlichen Akteuren, solchen der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft. Diese Dreiteilung ist weit verbreitet, darf aber nicht dahin gehend missverstanden werden, dass hier homogene Guppen bestünden. Die Auseinandersetzungen zu Themen der Regionalentwicklung können innerhalb dieser Kategorien höher sein als zwischen den Gruppen. Daher ist die Bildung von Akteursgruppen immer mit Vorsicht vorzunehmen und vor allem auch in Abhängigkeit von den zugrunde liegenden Fragestellungen. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, nicht von den öffentlichen Akteuren zu sprechen, sondern eine Unterscheidung zwischen der Politik – also den gewählten Vertretern – und der Verwaltung – also den ausführenden Stellen – vorzunehmen. Häufig werden Akteure als Stakeholder (engl. für Interessenvertreter) bezeichnet. Dies sind Anspruchsgruppen, die – beispielsweise als Kammern, Nichtregierungsorganisation, Gewerkschaft etc. – versuchen, ihre jeweiligen Interessen durchzusetzen, ohne nur den Entscheidungen der politischen Vertreter zu vertrauen.
Im Folgenden wird primär im Hinblick auf den steuernden Staat argumentiert, der explizit Regionen entwickeln will. Die weiteren Akteure, deren Handeln und Interessen, sind aber immer mitgedacht und werden auch immer wieder angesprochen.
1.6Zur Forschungspraxis der Regionalentwicklung: Methoden und Operationalisierung
1.6.1Regional(entwicklungs)analyse ?
Die Forschungspraxis der Regionalentwicklung ist nicht weniger vielfältig als die Untersuchungsobjekte regionaler Entwicklung es sind. Das gesamte Repertoire von Sozial-, Raum- und Planungswissenschaften, aber durchaus auch Elemente der naturwissenschaftlichen Forschung können hier potenziell von Bedeutung sein. Eine eigene Methodik für die Analyse der Regionalentwicklung gibt es dabei nicht – auch wenn einige Aspekte bei Operationalisierung und Erhebung besonders häufig zu verzeichnen sind. Dazu kann wohl gezählt werden, dass Fallstudien ein besonders häufig gewähltes Format sind, und hiermit auch die Methoden-Kombination (bspw. in der Kombination von Experteninterviews und Dokumentenanalyse als qualitativen Elementen mit sekundärstatischen Analysen oder repräsentativen Befragungen als quantitativen Methoden).
Im Folgenden sei zumindest kurz auf einige Punkte verwiesen, die vor allem in der anwendungsnahen Analyse häufig Herausforderungen darstellen.
Es ist häufig zu beobachten, dass Untersuchungen sich auf lediglich eine Region stützen, also sogenannte one-case-studies durchgeführt werden. Dies kann bei kompakten, anwendungsnahen Fragestellungen völlig berechtigt sein (z. B. Wohnraumbedarfsanalyse), auch kann in hermeneutisch und stark konzeptionell orientierten Fragen die Konzentration auf eine Region sinnvoll sein. Schließlich sind gelegentlich auch spektakuläre Einzelprojekte für sich genommen sehr aufschlussreich (z. B. zum Konflikt um die Umsetzung des Kopfbahnhofs in Stuttgart). Häufig ist aber eine komparative Betrachtungsweise vorzuziehen: Ein Gegenüberstellen verschiedener Fälle hilft die Aussagekraft abzusichern. In jedem Fall ist die Auswahl der Fallstudien theoriebegleitet vorzunehmen und zu begründen.
Grundsätzlich gilt, dass wenigstens eine Dimension der Fälle möglichst gleich sein sollte, damit die Unterschiede in einer anderen Dimension interpretierbar sind. Will man beispielsweise die Bedeutung von internationaler Fachkräfte-Migration auf regionaler Ebene untersuchen, so kann es sinnvoll sein, den Grad an metropolitaner Bedeutung der betrachteten Regionen in etwa ähnlich zu halten, damit es keine willkürliche Zusammenstellung von Einzelfällen wird.
Häufig besteht auch eine Abwägung zwischen Tiefe und Breite der Untersuchung (s. Thomas 2011). Möchte man beispielsweise verstehen, wie Lernprozesse in INTERREG-Projekten ablaufen, so kann man entweder möglichst viele Projekte betrachten und anhand eines standardisierten Indikators die Lerneffekte ‚messen‘ – dies kann beispielsweise in standardisierten Befragungen erfolgen. Möchte man hingegen die Prozesse des Lernens tiefgründiger verstehen und auch Lerneffekte erfassen, die den Beteiligten nicht unmittelbar bewusst sind, so bietet sich eine eher verstehende, induktive Vorgehensweise an, die mit ausführlichen Interviews und teilnehmender Beobachtung arbeitet (so erfolgt bei Hachmann 2011).
Читать дальше