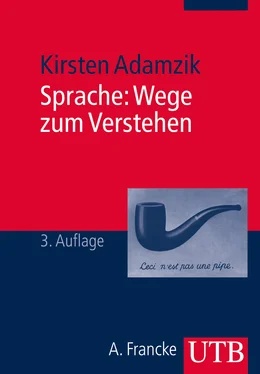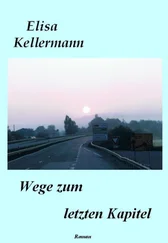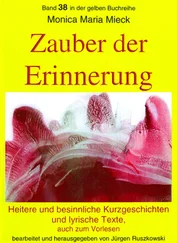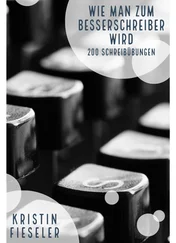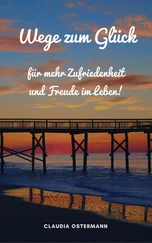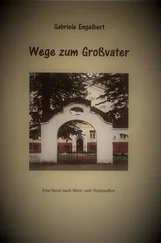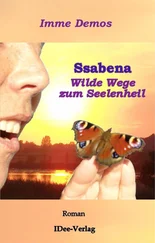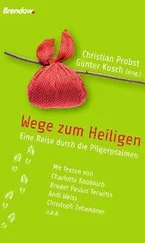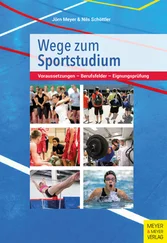Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? –
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In dürren Blättern säuselt der Wind. –
Der Vater identifiziert das Geräusch hier gar nicht als eines, das von einem sprachfähigen Wesen (wozu wir im Allgemeinen nur die Menschen zählen) produziert wurde. Wir können allgemein also schon einmal feststellen: Unter den vielen Geräuschen, die wir wahrnehmen, kommen wohl nur solche als sprachliche Äußerungen infrage, die Menschen erzeugt haben.
Nicht-sprachliche Geräusche
Menschen erzeugen aber auch nichtsprachliche Geräusche, z.B. wenn sie husten, schmatzen, schnarchen, vor Schmerz schreien oder in die Hände klatschen. Manche von diesen Geräuschen kommen unwillkürlich (husten) oder sogar unwissentlich (schnarchen) zustande, andere werden absichtlich produziert. Als sprachlich würden wir gewiss nur absichtlich erzeugte Geräusche ansehen, genauer gesagt: Geräusche, die eine Bedeutung haben, die nämlich in der Absicht erzeugt werden, dass jemand ihnen einen Sinn zuschreibt, sie als sprachliche Mitteilungen deutet und entschlüsselt.
Auch nicht-sprachliche Geräusche können Bedeutung tragen
Mit dieser Bestimmung können wir aber immer noch nicht Parole-Akte von allen anderen Geräuschen sicher abgrenzen. Man kann nämlich nicht nur sprachlichen Äußerungen einen Sinn zuschreiben, und nicht nur diese werden in der Absicht produziert, dass sie interpretiert und verstanden werden. So kann man z.B. auch absichtlich husten, um jemandem deutlich zu machen, dass er gerade etwas ganz Unpassendes sagt, oder schmatzen, um auszudrücken, dass einem das Essen schmeckt. Auch wer unwillkürlich hustet oder schmatzt, kann nicht verhindern, dass ein anderer dies deutet, etwa als Hinweis auf eine Erkältung oder schlechte Erziehung. Tatsächlich sind sprachliche Äußerungen nur Sonderfälle von Zeichengebrauch.
Etwas ist nicht Zeichen ›an sich‹, es wird als Zeichen interpretiert
Bevor wir klären, worin ihre Besonderheit denn nun besteht, bleiben wir zunächst noch allgemein beim Phänomen der Zeichen, denn was für Zeichen überhaupt gilt, gilt auch für sprachliche Zeichen. Wenn man von Zeichen spricht, denkt man oft zunächst an fixierte wahrnehmbare Produkte, denen konventionell eine bestimmte Bedeutung zukommt, z.B. an Verkehrszeichen, aber eben auch an
Der Zeichenprozess
Schriftzeichen, also Buchstaben. Wir verhalten uns dann so, als ob ein Zeichen direkt an seiner äußeren Gestalt als solches erkennbar wäre, als wenn Zeichen eine bestimmte Untergruppe wahrnehmbarer Objekte wären. Tatsächlich kann jedoch jedes beliebige Phänomen wie ein Zeichen behandelt oder aufgefasst werden, so z.B. wenn jemand |17◄ ►18| das, was er am Himmel sieht, als Zeichen für ein nahendes Gewitter deutet (das dann vielleicht gar nicht kommt) oder bestimmte Linien auf einer Landkarte als Geheimzeichen für einen verborgenen Schatz interpretiert (obwohl es sich vielleicht nur um Abdrücke irgendwelcher Gegenstände handelt, die lange darauf gelegen haben), oder wenn er schließlich ein bestimmtes grafisches Gebilde als ein Wort identifiziert (obwohl es sich vielleicht nur um Gekrakel handelt, das jemand beim Ausprobieren eines Füllers produziert hat). Etwas ist also nicht ›an sich‹ ein Zeichen, sondern es wird zu einem solchen immer nur für jemanden, es realisiert sich nur im Rahmen eines Interpretationsprozesses. Selbst sprachliche Äußerungen können nur dann als Zeichen funktionieren, wenn es auch jemanden gibt, der sie als Parole-Akte deutet und sie auf Grund seiner Sprachkenntnis entschlüsseln kann.
Auf dieser Grundlage können wir nun Zeichenprozesse zunehmend differenzieren bis hin zur Ebene sprachlicher Zeichen:
Ein Interpret deutet seine Wahrnehmung
– Damit ein Zeichenprozess zustandekommen kann, bedarf es erstens eines physischen Phänomens, das wahrnehmbar ist, und zweitens eines Interpreten, der seine Wahrnehmung zu deuten versucht. Das physische Phänomen als Bestandteil eines Zeichenprozesses wollen wir im Folgenden Zeichenträger oder Zeichenkörper nennen.
Ein ZeichenSetzer produziert etwas als Zeichen
– Damit von kommunikativem Zeichengebrauch die Rede sein kann, bedarf es außerdem auch noch eines »Zeichen-Setzers«, d.h. das physische Phänomen muss von jemandem absichtlich als Zeichenträger benutzt worden sein; er muss ihm seinerseits eine Bedeutung zugeordnet haben, etwas Bestimmtes damit gemeint haben.
Deiktische und ikonische Zeichen
Auch wenn man über keine gemeinsame Sprache verfügt, kann man sich bei Vorliegen dieser elementaren Gegebenheiten bereits verständigen, wie z.B. die Begegnung zwischen Robinson und Freitag (Textbeispiel 4) zeigt. Dabei wird man im Wesentlichen zwei Arten von Zeichen verwenden. Erstens kann man Zeigegesten benutzen. Dies tut man z.B. oft beim Einkaufen in Ländern, deren Sprache man nicht beherrscht: man zeigt dann einfach auf das, was man will. Solche Zeichen nennt man deiktische (von griech. deiknynai ›zeigen‹). Zweitens wird man auf solche Zeichenträger zurückgreifen, die in einer natürlichen oder jedenfalls leicht erratbaren Beziehung zum Gemeinten stehen, z.B. ein Gähnen, um zu zeigen, dass man müde ist, eine Zeichnung, die den gemeinten Gegenstand abbildet oder auch eine Lautung, die ein natürliches Geräusch nachahmt (z.B. kann man ein Bellen imitieren, um mitzuteilen, dass ein Hund in der Nähe ist). Solche Zeichen, bei denen die Zeichenkörper Abbildcharakter haben, nennt man ikonische Zeichen (von griech. eikon ›Abbild‹).
|18◄ ►19|
Textbeispiel 4: Ich verstand ihn ganz gut
Zwischen den Wilden und meiner Festung lag die Bucht. Über diese musste der Flüchtende schwimmen, wenn er nicht wieder eingefangen werden wollte. Er zögerte auch keinen Augenblick – obwohl die Flut hoch stand –, sprang ins Wasser, schwamm mit raschen Stößen herüber, kletterte ans Land und lief mit der gleichen Kraft und Ausdauer wie vorher weiter. Als seine drei Verfolger das Ufer der Bucht erreicht hatten, bemerkte ich, dass nur zwei von ihnen schwimmen konnten. Der dritte blieb am Ufer stehen und kehrte wieder um. Die beiden anderen brauchten noch einmal so viel Zeit wie ihr Gefangener, um über die Bucht zu schwimmen.
Ich konnte mich nicht länger zurückhalten. Jetzt war der Augenblick gekommen, mir einen Diener und vielleicht einen Gefährten und Freund zu verschaffen. Es schien mir, als hätte ich von der Vorsehung den Auftrag erhalten, das Leben dieses armen Geschöpfes zu retten. […]
Der arme verfolgte Wilde hatte seine beiden Feinde niederfallen sehen, Blitz und Knall des Schusses aber hatten ihn so erschreckt, dass er stocksteif dastand und sich nicht von der Stelle rührte, obwohl man es ihm ansah, dass er am liebsten davongestürzt wäre. Ich rief ihn nochmals an, winkte ihm und machte beruhigende Gesten. Er verstand mich und kam tatsächlich langsam näher und näher, zitterte aber am ganzen Körper. Ich nickte ihm freundlich zu und gab ihm auf alle mögliche Weise zu verstehen, dass ich sein Freund war. Als er vor mir stand, kniete er nieder, fasste meinen Fuß und setzte ihn auf seinen Kopf, wie mir schien, um mir damit zu sagen, dass er mein Diener sein wollte und ich sein Herr war. Ich hob ihn auf und beruhigte ihn, so gut ich konnte.
Allein, es gab jetzt noch mehr zu tun. Der erste Wilde, den ich niedergeschlagen hatte, war nicht tot, sondern nur betäubt und schien zu sich zu kommen. Als ich es merkte, zeigte ich auf den Niedergestürzten und mein Schützling sagte darauf einige Worte zu mir, die ich nicht verstand, die mich aber trotzdem vor Rührung fast erschauern ließen. Es waren die ersten Laute einer menschlichen Stimme, die ich seit fünfundzwanzig Jahren hörte! […]
Ich hatte inzwischen die Ziegen gemolken, die sich in dem ganz in der Nähe liegenden Gehege befanden. Kaum sah er mich, so lief er auf mich zu, kniete sich mit allen Zeichen demütiger Dankbarkeit wieder auf den Boden und deutete mir seine Ergebenheit mit allen erdenklichen Gesten an. Ich verstand ihn ganz gut und machte ihm begreiflich, dass ich mich über ihn freute.
Читать дальше