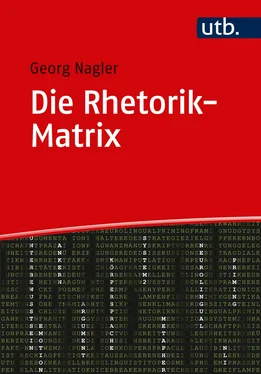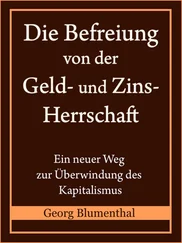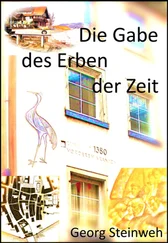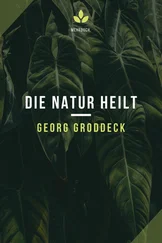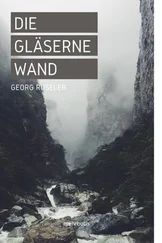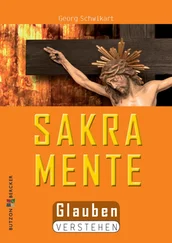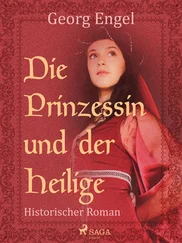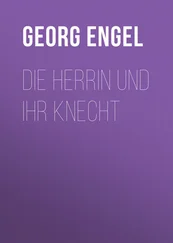Ein anderer nachweislicher Fall, der unglaublich erscheint: Ein Jahrmarktverkäufer preist ein echtes Sonderangebot von Fertigsuppen in besten Worten an. Gleichzeitig erwähnt er, dass es nur maximal 12 Dosen pro Kunde gebe. Im identischen Vergleichsfall wird die Rationierung nicht erwähnt. Das Resultat ist bemerkenswert: Im ersten Fall hat der Verkäufer dem System 1 der Kunden einen dramatisch wirkenden Anker gesetzt: Rationierung. Daraus schließt das unbewusste System 1 auf eine gewisse Dringlichkeit. Konsequenz: Es werden doppelt so viele Dosen erworben wie ohne den Anker! Wissen Sie jetzt, was der Hinweis auslöst „Solange der Vorrat reicht“? (Kahneman, S. 160)
In vielen Experimenten hat die Psychologie die Wirkmächtigkeit derartiger Anker herausgearbeitet – die natürlich auch in Reden ohne weiteres Anwendung finden können. Hier ein zugegebenermaßen fieses Beispieldafür (SZ vom 18.2.2016): „2015 hatten wir etwa 1 Million Zuwanderer. Es ist eine Tatsache, dass sich die Zahl der Straftaten durch Zuwanderer verdoppelt hat – auf über 200000 Straftaten“ – der hier gesetzte Zahlen-Anker bezieht sich auf die von der Presse völlig korrekt wiedergegebene Zahl der Straftaten aller Zuwanderer insgesamt, die das Bundeskriminalamt bekannt gab. Eine – natürlich nur stichprobenartige – Erhebung unter meinen Studierenden erbrachte als Ergebnis, dass diese weit überwiegend davon ausgingen, dass jeder fünfte neue Zuwanderer2015 straffällig wurde – obwohl sich die Zahl der Straftaten auf die Gesamtzahl der Zuwanderer in Deutschland bezog: Die Kriminalitätsrate lag daher faktisch nicht einmal ein Viertel so hoch! Gleichwohl wirkte die angebotene Zahl als glaubwürdig dergestalt, dass niemand auch nur ansatzweise dieses Zahlenverhältnis in Frage stellen wollte.
Die Macht des unbewussten System 1 und seine massiven und permanenten Auswirkungen auf das bewusste System 2 werden dabei nach allgemeiner Meinung der Psychologie von den meisten Menschen völlig unterschätzt (vgl. Kahneman, S. 162). Dies ist eine wichtige Chance für eine effizienzorientierte Rhetorik, um hier erneut wirkungsvoll zu punkten. Wer Anker setzt, hat den Hörer an einem Haken, der unsichtbar ist und daher umso einflussreicher sein kann!
c) Framing
Die beiden Phänomene von Priming und Ankern zeigen, wie das unbewusste System 1 bereits durch wenige vorgegebene Informationen beeinflusst werden kann, die ein Redner bzw. Gesprächspartner bewusst vorgibt. Dies lässt den Schluss zu, dass auch ganze „Gedankenrahmen“, die von einem Redner vorgegeben werden, das Denken des Zuhörers, insbesondere über sein unbewusstes Assoziationssystem, aktiv beeinflussen können (s. dazu auch Bechmann, Sprachwandel – Bedeutungswandel, S. 270ff.). Das zentrale Ergebnis einer Studie dazu ist bei Elisabeth Wehling nachzulesen (vgl. Wehling, S. 76, nach Zhong/Liljenquist). Zwei Versuchsgruppen mussten einen Text Wort für Wort abschreiben:
Der Text der einen Gruppe handelte von einer guten Tat – jemand hatte einem Kollegen geholfen. Der Text der anderen Gruppe dagegen behandelte eine schlechte Tat – jemand hatte gegen seinen Kollegen intrigiert. Danach sollten die Teilnehmer angeben, wie sehr ihnen bestimmte Produkte gefielen. Und um solche Produkte ging es: Zahnpasta, Seife, Glasreiniger, Desinfektionstücher, Waschpulver, Orangensaft, Batterien, Post-It-sticker, CD-Hülle, Snickers und einiges mehr. Sie ahnen es schon: Diejenigen Teilnehmer, die eine schlechte Tat hatten abschreiben müssen, stuften die Reinigungsprodukte als viel attraktiver ein als jene, die von einer guten Tat geschrieben hatten.
Auslöser war ein assoziativer Frame: Moral wird mit Reinheit weitgehend gleichgesetzt und assoziiert. Die Folge der Assoziation war ein unmittelbarer Einfluss auf das Wahlverhalten der „unmoralischen“ Gruppe: Sie suchte nach Reinigung, natürlich im assoziativen Sinn. In einem vergleichbaren Setting wurden die beiden Testgruppen gefragt, ob sie bleiben und unentgeltlich einen Studierenden bei einem Projekt unterstützen wollten. Das Ergebnis verblüfft nicht weiter: 70 Prozent der „Unreinen“ entschieden sich, dem Studierenden zu helfen (und sich so zu rituell zu reinigen) – bei den „Reinen“ belief sich dieser Anteil nur auf 40 Prozent (Wehling, S. 77).
Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Beispiele, Zitate, Geschichten können ganze Assoziationsketten auslösen, die das weitere kommunikative Denken des Zuhörers voreinstellen. Man spricht dabei vom „metaphorischen Mapping“ – es werden also regelrechte moralische Koordinatensysteme im Unterbewusstsein angestoßen und ausgelöst, die das weitere Denken und Sprechen sowie das weitere Handeln nachweislich beeinflussen können (vgl. Wehling, S. 77f.). Selbst kontroverse Diskussionen können so gezielt gesteuert werden. Wehling beschreibt unter anderem das metaphorische Framing der „Vertikalisierung“: Gutes/Gott ist oben angesiedelt; Schlechtes/der Teufel unten. Daraus folge, dass Bürger mit viel Vermögen als „Oberschicht“ und damit implizit als „die Guten“ bezeichnet werden, während der Begriff „Unterschicht“ eine eindeutige Stigmatisierung der dazugehörenden ärmeren Mitbürger beinhalte (vgl. Wehling, S. 120). Ähnlich verhält es sich mit den Begriffen „Mindestlohn“ und „Lohnuntergrenze“, mit denen zwei unterschiedliche „Viewpoints“, also linguistisch verschlüsselte Positionierungen zum gleichen Thema gesetzt werden (Wehling, S. 137; s. auch unten S. 83).
Ist ein solcher Rahmen erst einmal vom Redner bewusst gewählt und dann gesetzt worden, so wird er beim Zuhörer zwangsläufig Assoziationsprozesse im Weg der kognitiven Simulation auslösen, die davon beeinflusst werden. Und je mehr der Redner dieses assoziative Gerüst weiter bedient, umso wirksamer wird das aktivierte unterbewusste System 1 dies affirmativ unterstützen: Diese Assoziationen hat es schließlich gelernt und im Unterbewusstsein als Lerneinheit gespeichert. Wer etwa vom „Humankapital“ spricht, der entpersönlicht Diskussionen – Arbeit wird zur rein betriebswirtschaftlich zu behandelnden Ressource. Ist der Einzelne hingegen einer, der für den „Daimler“, „Bosch“ oder andere hart arbeitet – dann belegt er als Malocher oder treuer Arbeitnehmer, dass der Verlust eines Arbeitsplatzes ungemein stärker wirkt als der Begriff vom „Arbeitsabbau“ (vgl. Wehling, S. 139f.): „Wegrationalisierung“ wäre hier eine begriffliche Alternative, die deutlich negativer wirkt. Der assoziative Rahmen kann also bewusst durch solche wertenden Frames voreingestellt werden, was etwa in Podiumsdiskussionen durchaus erfolgsentscheidend sein kann.
Auch zum wirksamen Framing fehlen noch exakte wissenschaftliche Erkenntnisse, die dazu eine ganze Theorie formulieren können. Eines steht aber fest: Wir als „Humans“ lassen uns in unserem unbewussten System 1 massiv durch vorgegebene assoziative Frames in unserem Denken beeinflussen. Wer also für sich in bewusster sorgfältiger Auswahl den richtigen Sprachrahmen, die richtigen Metaphern und metaphorischen Rahmen setzt, kann zu seinen Gunsten einigen Einfluss auf das unbewusste System 1 des Zuhörers ausüben. Dieser Effekt wird sich auch auf das bewusste Denken des Zuhörers sehr subtil auswirken und kann dem Redeerfolg durchaus nachhaltig zugutekommen.
4. Rhetorik für „Econs“ (Vernunftmenschen) oder „Humans“ (Alltagsmenschen)?
Die Rhetorik als Wissenschaft war und ist seit Jahrtausenden darauf ausgelegt, auf den Grundlagen von sittlicher Vernunft, Argumentation und rationaler Entscheidungsfindung die wesentlichen Ziele von Wahrheitsfindung und Überzeugung durch richtiges Reden zu erreichen. Dabei stehen der „Ethos“ des Redners (seine Autorität und Glaubwürdigkeit) sowie der „Logos“ der Rede (die Beweis- und Argumentationsführung) im Vordergrund, wie etwa Aristoteles in seinem Standardwerk „Rhetorik“ ausführt (Aristoteles, Rhetorik, S. 11f.; s.a. Krieger/Hantschel, Handbuch Rhetorik, S. 18). Psychologische Elemente der Redekunst waren zwar bekannt; sie konnten mangels der Kenntnis der Psychologie als Wissenschaft aber nur unvollständig beschrieben und eingeordnet werden: In der Benutzung von rhetorischen Elementen, die das „Gefühl“ beeinflussen sollten, also der rhetorischen Funktion des Pathos, liegt das Hauptfeld dessen, was zwar als rhetorisch wirksam bekannt, aber letztlich nicht in seinen Wirkmechanismen verstanden war.
Читать дальше