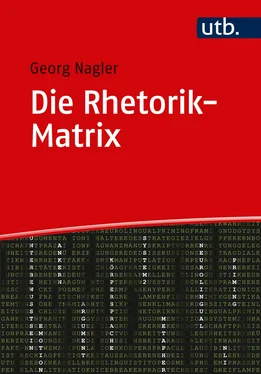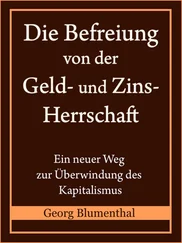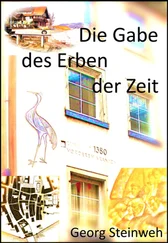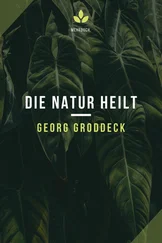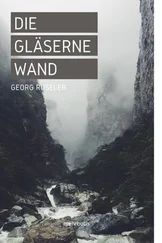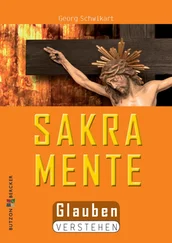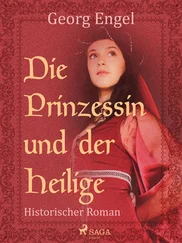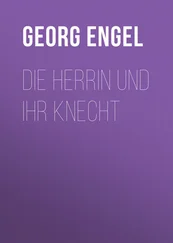Die Rhetorik war damit am Vernunftmenschenausgerichtet – genauso wie die klassische Volkswirtschaft am Econ, dem rationalen Entscheider/Agenten von wirtschaftlichen Sachverhalten (vgl. Kahneman, S. 508f.). Die Geschichte der Wortschöpfung „Econs vs. Humans“ ist auch bei Thaler/Sunstein in ihrem grundlegenden Buch „Nudge – Wie man kluge Entscheidungen anstößt“ nachzulesen (S. 16ff.); Richard Thaler hat für diese Theorien mit Recht den Wirtschaftsnobelpreis 2017 erhalten. Im Mittelpunkt der Rhetorik stand der Wettstreit der Econs um die Wahrheit vor dem Hintergrund des Einsatzes vernunftbetonter Argumente. Wer davon abwich und die „dunkle Seite“ der Rhetorik anging, die Kunst der Manipulationund der Verführung, der wurde schnell mit dem Verdikt der Demagogie belegt, also verdächtigt, Rhetorik bewusst zur Propaganda und Massenlenkung zu missbrauchen. Die Opfer waren dann die „verführbaren Humans“, die Alltagsmenschen, die allzu leicht den „schwarzen Redekünsten“ auf den Leim gingen. Zu denken ist etwa an den rhetorischen Super-Beelzebub Josef Goebbels, der beispielsweise in seiner berüchtigten Sportpalastrede zum „totalen Krieg“ 1943 das ABC der dunklen Rhetorik gnadenlos – und auch gnadenlos wirkungsvoll – durchdeklinierte.
Die moderne Psychologie bringt uns in der Rhetorik einen sehr nüchternen und klaren Standpunkt bei: Es gibt in der Rhetorik keine Econs! Es gibt nur Humans! Wirkungsvolle Rhetorik ohne die Berücksichtigung der elementaren psychologischen Grundlagen unseres Denkens ist schlichtweg nicht möglich. Letztlich gibt es kein rhetorisches Phänomen, das sich nicht diese Grundlagen zunutze macht. Rhetorik ist daher untrennbar mit der Bereitschaft verbunden, auch psychologische Wirkmechanismen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu zu nutzen. Gesicherte Forschungsergebnisse der modernen Neurobiologie und Verhaltenswissenschaften einzubeziehen, ist korrektes wissenschaftliches Verhalten. Dies ist – noch – keine Manipulation. Wer die Redekunst beherrschen will, muss künftig das ganze, und damit auch das psychologische Instrumentarium der Beeinflussung des Menschen als Human kennen und auch anwenden wollen. Die Frage der Demagogie ist eine der ethischen Bewertung des Einsatzes von Redekunst, und dann ganz gleich, ob religiöser Demagoge (etwa ein salafistischer Prediger) oder politischer Demagoge (z.B. der rechtsradikale Nazi).
Der Einsatz dieser modernen Erkenntnisse, deren Verwendung für die Rhetorik ich im Folgenden als neurolinguale Intervention (NLI)bezeichne, ist für den modernen Redner unausweichlich. Ihr Potential kann verglichen werden mit einem „Treibsatz“ in der Chemie: Man kann mit ihm formen (etwa im Druckpressverfahren), man kann mit ihm Raketen für friedliche Missionen starten. Aber man kann damit auch zerstören (als Sprengstoff). Es liegt an uns, wie wir unser Wissen über die Wirkung rhetorischer Mittel verantwortungsvoll einsetzen.
Der weitere Aufbau des Buches trägt dieser Herausforderung an die moderne Rhetorik Rechnung: Jedem „klassischen“ Thema der Redekunst, das man aus der Literatur und Praxis auch bislang kennt, wird der „wirkungspsychologische“ Ansatz zugeordnet, der für Redner und Hörer relevant ist. Daraus ergeben sich manche interessante Querverbindungen und Aha-Effekte zu Erkenntnissen, wie wir sie etwa in den kurzweiligen Büchern von Rolf Dobelli zur „Kunst des klaren Denkens“ und „klugen Handelns“ aktuell erstaunt für unser wirtschaftliches Denken aufnehmen. Auch in der Rhetorik zeigt sich, wie profund wir im Alltagsleben mit Täuschungen und Illusionen konfrontiert werden, ihnen erliegen und trotzdem Erfolg haben können. Das Verständnis dieses Phänomens ist besonders wichtig für heute junge Menschen und die künftigen Generationen, die von Anfang an mit diesem Rüstzeug werden leben müssen. Auch in Zukunft wird erfolgreiche Kommunikation sich nicht auf Wischen und Klicken beschränken können. Wer nur „World of Warcraft“ spielt, wird wohl allenfalls virtuell erfolgreich sein. Es ist und bleibt eine Illusion. Wer aber bereit ist, in Echtzeit auf modernster Grundlage rhetorisch zu sprechen, zu kommunizieren und zu führen, der kann das reale Game of Power gewinnen oder zumindest erfolgreich im Beruf und Privatleben sein.
III. Der Hörer ist das Ziel: Was ein Redner bei seinen Hörern voraussetzen kann – und wie er an sie herankommt
1. Die Interaktion Redner – Hörer
Nachdem wir die wesentlichen modernen Erkenntnisse erarbeitet haben, die dem kommunikativen Denken zugrunde liegen, können wir uns nun der Interaktion zwischen Redner und Hörer/Zuschauer zuwenden. Diese Interaktion heißt Kommunikation. Und auch hierfür gibt es einige wesentliche Grundlagen, die wir als Redner unbedingt kennen sollten: Nur dann können wir wirksam beeinflussen. Sollten Sie dies vertiefen wollen, darf ich Ihnen dazu eine Empfehlung mitgeben: Das deutsche Standardbuch hierzu ist nach wie vor von Friedemann Schulz von Thun „Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation“; es erscheint seit über 30 Jahren mittlerweile in der 54. Auflage (s.a. zu den psychologischen Grundlagen Höhle, Psycholinguistik).
Grundlage der wirksamen Kommunikation ist die Erkenntnis, dass sie auf verschiedenenKanälen parallelerfolgt. Wir kennen zwei Hauptkanäle: Verbale Kommunikationund nonverbale Kommunikation. Beide Aktivitätsebenen „produziert“ der Redner zur gleichen Zeit und parallel. Und nur dann, wenn beide „Produkte“ authentisch und glaubwürdig parallel beim Zuhörer ankommen, wird dieser den Redner und seine Rede akzeptieren.
Da wir uns der nonverbalen Kommunikation noch später intensiv widmen, zuerst eine Darlegung der wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur verbalen Kommunikation. Die verbale Kommunikationist – wie wir mittlerweile wissen – ein „Gemeinschaftsprodukt“ von unbewusstem System 1 und bewusstem System 2. Diese Kooperation führt letztlich zu vier potentiellen Inhalten einer Redeund damit ihrer Kommunikationsaussage:
1 Die Sachinformation: Hier wird, klar von System 2 überwacht, das mitgeteilt, was sachlich-objektiv vermittelt werden soll.
2 Die Selbstkundgabe: Der Produktion der Sachinformation geht in wenigen Millisekunden in den aktivierten Gehirnteilen eine kaum messbare Fülle von neuronalen Abgleich-, Emotions- und Generationsprozessen voraus, die tief in den unbewussten Teil des System 1 hineinreichen. Damit ist unvermeidlich, dass wir auch viel von dem kundgeben, was buchstäblich „in uns arbeitet“, wie wir zu der mitgeteilten Information stehen: Zuversicht, Konstruktivität, Sorge, Destruktivität, neutrale Einstellung und vieles andere mehr. Wir haben dabei schon drei Instrumente kennen gelernt, die hier reflexiv unsere Einstellung mit beeinflussen: das Priming, das Ankern und das Framing (s.o. S. 31ff.). Dies gilt nicht nur für den Zuhörer, sondern auch für den Redner selbst: Wenn er zum Beispiel einen inhaltlichen Frame/Rahmen setzt, dann gibt er bewusst und auch unbewusst, also auf beiden Ebenen, kund, innerhalb dieses Frames weitersprechen und seine Gedanken an den Hörer vermitteln zu wollen. Gerade die Beeinflussung der unbewussten Gedankenführung darf hier nicht ausgeklammert werden; Frames können sich dabei über die Sprachverarbeitung hinaus sogar auf die Wahrnehmung auswirken (vgl. Wehling mit Beispielen, S. 32f.).Ein kleines Beispiel aus meiner Praxis: Bei der Besprechung eines studentischen Projektes zur beruflichen Integration von Flüchtlingen ging es um die Frage von Eignungskriterien, die Flüchtlinge für eine Studienrichtung erfüllen sollten. Ich erwähnte dabei scherzhaft ein bekanntes Leitmotto der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München: „Wir nehmen jeden“, um zu demonstrieren, dass man in einem Studienprojekt eben nicht jeden nehmen könne. Dies führte dazu, dass die Projektleiterin im folgenden Redebeitrag ausführte, welche Eigenschaften sie von ausgewählten Häftlingen (nicht Flüchtlingen!) erwarte. Errötend beschrieb sie mir später die unbewusste Denksequenz, die zu diesem belachten Versprecher führte – der Inhalt der Selbstkundgabe war Abgelenktsein und die Verarbeitung einer persönlichen Erfahrung.
Читать дальше