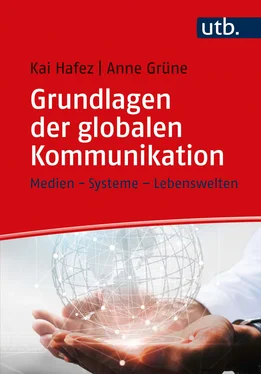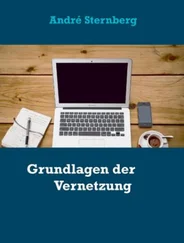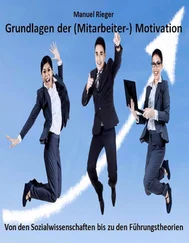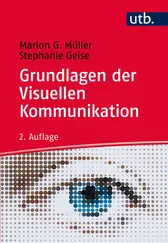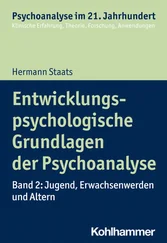Deutet man diese Ansätze auf Basis der Habermasianischen Öffentlichkeitstheorie, so wird von beiden Autoren eine Akzentverschiebung von der System- zur Lebensweltberichterstattung verlangt. In diese Richtung weisen auch Ansätze des „konstruktiven“ beziehungsweise „positiven Journalismus“, die sich durch eine Hinwendung zu Lebenswelthemen eine Korrektur des Negativbias von Auslandsnachrichten versprechen (Hafez/Grüne 2015). Derartige Ansätze machen deutlich, dass die Negativitätsfixierung der Auslandsberichterstattung nicht zuletzt den Populismus stärkt (Haagerup 2014, Russ-Mohl 2017). Eine entsprechende Neudefinition der Nachrichtenwerte wird gefordert.
In eine ähnliche Richtung zielen Ansätze eines „kosmopolitischen Journalismus“, wenngleich unter leicht veränderten Vorzeichen. Negativanlässe sollen hier nicht weniger vom Journalismus beachtet werden, wie im „konstruktiven Journalismus“, sondern gezielt erörtert werden, zum Beispiel bei Fluchtkrisen. Allerdings sollen die Ereignisse anders interpretiert werden als in der konventionellen Medienberichterstattung. Nicht mehr die stereotype Darstellung von Geflüchteten als bedrohliche Masse, sondern individuelle Schicksale und vor allem die Mitverantwortung der internationalen Politik und der Großmächte sowie die komplexen politischen und ökonomischen Weltbeziehungen sollen im Vordergrund stehen (Chouliaraki 2006, Silverstone 2007, Lindell/Karlsson 2016, Schmidt 2017).
Hier besteht zugleich eine Verwandtschaft zum dialogischen wie auch zum konstruktiven Journalismus, da auch im kosmopolitischen Journalismus Interdiskursivität wichtig ist, um die Reflexivität über „das Eigene und das Fremde“ zu verbessern und so kosmopolitische Impulse in die Einwanderungsgesellschaft zu senden. Alle drei alternativen Strömungen der Öffentlichkeitstheorie verschmelzen daher gewissermaßen in Ingrid Volkmers Ansatz zur „reflexiven Interdependenz“ der Weltöffentlichkeit, in dem sie Interdiskursivität, Lebensweltorientierung und Kosmopolitismus als neue Horizonte skizziert (2014, S.163ff.). Sich explizit auf Habermas, aber auch auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Immanuel Kant und John Rawls beziehend, beschreibt sie die gesellschaftlichen Veränderungen der Globalisierung insofern als fundamental, als Menschen im global reflexiven Journalismus nicht als „Fremde“, sondern als das globale „Selbst“ in Erscheinung träten. Die gesellschaftliche Reproduktion lokaler Identitäten, die durch isolierte Mediendiskurse entsteht, soll so abgemildert werden.
Weltöffentlichkeit und Global Governance: das Beispiel Europas
Europa und die Europäische Union sind ein Beispiel dafür, wie Medienberichterstattung sich auf die internationale Politik auswirkt. Als zentrales Ergebnis von Inhaltsanalysen kann festgehalten werden, dass eine gewisse thematische Konvergenz der Europaberichterstattung in den nationalen Medien Europas als Mindestkriterium einer europäischen Öffentlichkeit vorhanden ist. Jedoch ist das Framing vielfach national geprägt und wenig interdiskursiv ausgerichtet. In der wissenschaftlichen Literatur wird die mediale Domestizierung als hinderlich für die spezifische Form der Global Governance innerhalb der EU betrachtet, da diese zwar kein Bundesstaat ist, aber seit den Verträgen von Maastricht 1992 ein mit starken transnationalen Kompetenzen ausgestatteter Staatenbund (Splichal 2012, S.145ff.). Da aber die Medien und die Medienpolitik fast gänzlich in der Hand der Nationalstaaten liegen, somit der Einfluss der nationalen Politik auf die Medien enorm hoch ist, werden dezentrale Positionen gestärkt und die europäische Konsensbildung erschwert, während die Brüsseler Politik beständig um ihr Image kämpfen muss, weil sie als einzige politische Kraft über keinen strukturell abgesicherten Medieneinfluss verfügt.
Die meisten Autoren fordern in dieser Situation weniger die Schaffung transnationaler Medien als die bessere Verzahnung der nationalen Medien, um die Interdiskursivität der Medien zu verbessern (Habermas 2001, S.120, vgl. a. Gerhards 1993, 2000, Wessler/Brüggemann 2012, S.62). Die Vorstellung der Etablierung transnationaler europäischer Medien wird hingegen als „naives Modell“ bezeichnet, denn eine globale Nachrichtensendung von hoher Reichweite werde es „sicherlich nie geben“ (Wessler/Brüggemann 2012, S.65, vgl. a. Lingenberg 2010, S.118). Allerdings ist anzumerken, dass historisch wohl noch keine politische Formation entstanden ist, die nicht über die ihr entsprechenden Medien verfügte. Wie der moderne Nationalstaat von nationalen Medien begleitet und ermöglicht wurde, werden wohl auch globale Politikformen nur dann erfolgreich sein, wenn es wirkliche transnationale Medien gibt, die nicht mehr wie die heutigen Medien CNN, Al-Jazeera usw. im Grunde an Nationalstaaten gekoppelt sind. Die neuen Medien müssten nationale Medien nicht ersetzen, da diese innerhalb ihrer Sprachräume ideal angepasst und potenziell wichtige „Übersetzer“ in der Globalisierung sind. Sie wären aber gerade unter Krisenbedingungen weniger anfällig für nationale Alleingänge und könnten insofern die Informationsdefizite europäischer Bürger effektiver kompensieren (Morganti/Audenhove 2011). Das nationale Arenenmodell von Habermas und anderen wird daher andernorts als „Fehlkonzeption“ ( misconception ) bezeichnet, so dass wir von einer schwelenden wissenschaftlichen Kontroverse über die Etablierung unabhängiger europäischer Medien sprechen können (Ambrosi 2011, S.240).
Europa steht damit beispielgebend für andere transnationale Räume wie die Vereinten Nationen, Mercosur, NAFTA, die OECD oder ASEAN vor einem komplexen Entwicklungsproblem. Wenn Öffentlichkeit zur Legitimation von Herrschaft in der Moderne wichtig ist, dann wird Global Governance wahrscheinlich nur durch ein komplexes Zusammenspiel von stärker synchronisierten nationalen Medien und als unabhängige Instanzen etablierten transnationalen Massenmedien unterstützt werden. Man könnte auch von einer Kombination aus horizontaler und vertikaler globaler Massenkommunikation sprechen. Sowohl der „Brexit“ (ab 2016) als auch die Griechenlandkrise (ab 2010) haben neben allen politischen und ökonomischen Verwerfungen ihre Ursache auch im Versagen nationaler Medien im Kontext der EU. Massenmedien weiterhin als nationale Kulturgüter zu betrachten, wie es die europäischen Verträge der EU tun, während man zugleich Europawahlen abhält, ist eine Konstruktion, deren innere Widersprüche sich nicht allein durch Appelle an eine pan-europäische Medienethik lösen lassen werden, sondern immer auch durch Weiterentwicklungen der bestehenden Mediensysteme realisiert werden müssen. Zu den nationalen Arenen als Ort der Transnationalisierung muss also geradezu zwangsläufig ein direkter medialer Draht zwischen europäischen Bürgern und Bürgerinnen, dem Parlament in Straßburg und der Brüsseler Exekutive durch pan-europäische Medien und verbesserte journalistische Vernetzungen kommen (Ratavaara 2013). Mit dem wachsenden Zuspruch, den solche pan-europäischen Medien bei den Konsumenten fänden, würden sie auch in die Rolle von Leitmedien des nationalen europäischen Journalismus im Prozess der Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten hineinwachsen, was den derzeitigen Medien wie Euronews noch nicht hinreichend gelingt (Brüggemann/Schulz-Forberg 2009).
Gesamtfazit: Weltöffentlichkeit, Weltgesellschaft und verzögerter Strukturwandel der Massenmedien
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass globale Massenkommunikation von transnationalen Kommunikationsflüssen sowie von einer zunehmenden Zahl transnationaler Medien und transnationaler Medienstrukturen auf allen Ebenen (Medienethik, -produktion, -rezeption, -regulation, -ökonomie) gekennzeichnet ist. Die nationale oder geokulturelle Prägung der meisten Medien ist aber strukturell, das heißt im Organisationsaufbau sowie in den primären Umweltbezügen von Politik, Ökonomie und Märkten nicht zu verleugnen. Diese globale Interdependenzlücke der globalen Massenkommunikation korreliert, ohne allzu strukturalistisch argumentieren zu wollen, in hohem Maße mit fragmentarischen, national oder anderweitig lokal gefärbten Mediendiskursen. Es gibt bislang keine Hinweise, dass im Internet in markanter Weise und von Nischen abgesehen ein echter globaler Gegenentwurf zum partikularen Journalismus entstünde.
Читать дальше