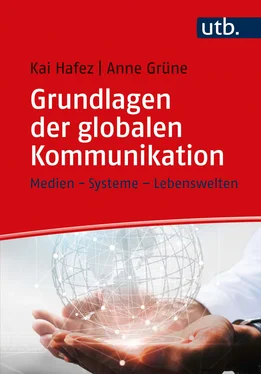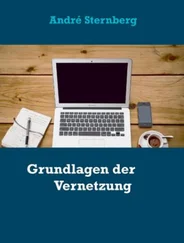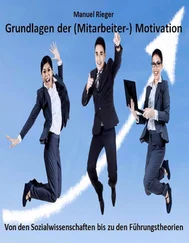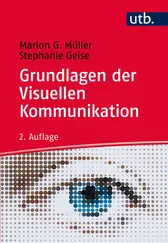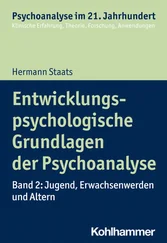Interessant ist hier, dass die meisten Empiriker der Konvergenz (vgl. Kap. 2.2.1), egal ob sie eher Pessimisten oder Optimisten sind, im Kern dieselben öffentlichkeitstheoretischen und normativen Konvergenzziele verfolgen, auch wenn sie die Umsetzung in der Gegenwart unterschiedlich bilanzieren. Auch Diskurspessimisten wollen also Konvergenz, sehen aber Domestizierung als vorherrschend an, da sowohl Thematisierung und Framing als auch visuelle Gestaltung stark lokal gefärbt sind. Eine funktionierende Weltöffentlichkeit kann bei einer derartig eingeschränkten Synchronisation auf diese Weise nicht entstehen (Sparks 1998, 2000, Couldry 2014).
Nancy Fraser hat darauf hingewiesen, dass das Konzept Öffentlichkeit für den globalen Raum insofern neu durchdacht werden muss, als zum Beispiel gar nicht unmittelbar klar ist, in welcher Sprache der Diskurs geführt werden soll und wer die relevanten Akteure (Staaten, Gegeneliten) und Publika sein sollen (Fraser 2014, S.27). Weltöffentlichkeit kann entweder durch die Synchronisierung nationaler Öffentlichkeiten in national getrennten Mediensystemen oder durch die Etablierung eines transnationalen Mediensystems geleistet werden (Ulrich 2016, S.111ff.). Beide Modelle haben Vor- und Nachteile, da ein transnationales Mediensystem sich die Filterung durch nationale Systeme ersparen würde, nationale Systeme aber auch als nationale „Übersetzungshilfen“ und Kontextualisierungen für internationale Probleme fungieren können. Die meisten Theoretiker neigen daher zum pragmatischen Verfahren der Synchronisierung durch nationale Systeme, das aber bislang in hohem Maße an der Interdiskursivität gescheitert zu sein scheint. Die Herausbildung eines „Konsenses“ in der Weltöffentlichkeit ist zudem im nationalen Modell technisch kaum möglich, so dass Transnationalismus zumindest als zweite Säule der Weltöffentlichkeit erhalten bleiben muss.
Aus der Perspektive einer anderen Theorie, nämlich der Systemtheorie, ist die deliberative Öffentlichkeitstheorie, egal ob optimistisch oder pessimistisch beurteilt, ohnehin nichts als ein Ausdruck des „Hyperglobalismus“ (Werron 2010, vgl. Kap. 2.2.1). Aus Sicht der Systemtheorie in der Tradition Niklas Luhmanns erscheint es nicht so wichtig, wie sich Nationen durch Mediendiskurse verbinden und ob sie sich synchronisieren, sondern dass sie sich verbinden, denn jede Form der Konnektivität birgt die Chance auf gesellschaftliche Anschlusskommunikation (Luhmann 1970, Axford 2012, S.38, 45). In der Systemtheorie geht es primär um eine Reduktion von Umweltkomplexität, die Themenstrukturierungsleistung der Medien an sich ist wichtiger als ein bestimmter partizipativer und demokratischer Modus (Böckelmann 1975). Bei Luhmann ist daher auch „Weltgesellschaft“ vergleichsweise offen definiert, sie entsteht durch beliebige grenzüberschreitende Kommunikation und hat keinerlei Verwandtschaft mit dem Konstrukt der globalen Zivilgesellschaft ( global civil society ) (vgl. Kap. 5). In der Systemtheorie ist weder Qualität des Journalismus noch die Frage, ob Information oder Unterhaltung vermittelt wird, von Belang. Vielmehr steht eine postmoderne Ansammlung disperser Individualmeinungen im Vordergrund. Aus dieser Sicht gibt es am derzeitigen Zustand des globalen Mediendiskurses nichts auszusetzen. Fragmentarische Themenhaushalte und Frames, verbale und visuelle Stereotype oder auch defizitäre Sprecherreferenzialität sind in dieser Wissenschaftsschule samt und sonders legitime Weltbildkonstruktionen der Postmoderne.
Die Rolle der Weltöffentlichkeit für die Weltgesellschaft
Allerdings werden die Grenzen dieser Sichtweise deutlich, wenn man versteht, dass mit ihr auch Kriegspropaganda und rassistische Aufladungen in Massenmedien gerechtfertigt werden können (Hafez 2010, 2017b). Zwar sollte man die strukturelle Überforderung der deliberativen Theorie der Weltöffentlichkeit erkennen. Zugleich muss man aber vor der strukturellen Unterforderung durch die Systemtheorie warnen, die als grundlegende Makrotheorie keine praktikable Gesellschaftstheorie zu sein scheint. Medien verfügen aus der Sicht der deliberativen Öffentlichkeitstheorie über ein „ambivalentes Potenzial“ insofern, als sie durch ihre Angebote einerseits die Grundlagen zur Herstellung von Öffentlichkeit legen, die Medien aber den Raum der möglichen Kommunikation andererseits „hierarchisieren und einschränken“ (Burkart/Lang 2004, S.63ff.). Im Falle der globalen Kommunikation lassen sich Wirkpotenziale der globalen Massenkommunikation innerhalb wie außerhalb nationaler Systeme beobachten, die unter den Begriffen „Kosmopolitismus“ und „Global Governance“ firmieren können.
Auslandsberichterstattung hat direkte Auswirkungen auf die Haltung der Gesellschaft zu Fragen des Kosmopolitismus, Multikulturalismus und Rassismus. Menschen greifen in der Tendenz bei Fernbildern auf Medienwissen und bei Nahbildern auf eigene Erfahrungen zurück (Kruck 2008). Probleme entstehen insofern, weil Rassismus auf Vorurteilen gegenüber dem „abwesenden Fremden“ basiert, also keine Reaktion auf Fremde in der Nahumwelt ist, sondern die in den Medien konstruierte „chaotische Welt“, die dann aber auf die „Fremden“ in der Nahwelt („die Ausländer“ usw.) übertragen wird, zu denen kein Konkakt und über die also kein direktes Erfahrungswissen besteht (Chouliaraki 2006, Hafez 2002a, Bd.2, S.261ff.). Dabei darf man allerdings den Einfluss anderer Sozialisationsinstanzen (Familie, Gemeinschaft, Institutionen) auf Kernwerte des Menschen nicht unterschätzen (Hafez 2011, S.488f.).
Was die Frage der internationalen Wirkungen angeht, so gilt ein großer Teil der Rezipienten und Rezipientinnen als „passiv“, da diese an Auslandsnachrichten wenig interessiert sind oder primär auf Meinungen der Eliten, die sie in den Medien vorfinden, reagieren (die ihrerseits aber öffentliche Werte und Stimmungen antizipieren) (Powlick/Katz 1998). Die meisten Studien fragen dabei allerdings nach dem Interesse der Rezipienten und Rezipientinnen an internationaler Politik, nicht aber an der Welt als solches (Hafez 2011, S.490f.), was seinen Grund wohl darin hat, dass die Forschung annimmt, dass die meisten Publika ohnehin eher auf konkrete und konfliktive Ereignisse und nicht auf Lebensweltentwicklungen reagieren (Wanta/Hu 1993). In jedem Fall ist man sich einig, dass ohne Medienresonanz des Globalen auch keine Debatten über das Globale entstehen. Je mehr über ein Land berichtet wird, umso eher gehen Rezipienten davon aus, dass dieses Land bedeutsam ist; je negativer dies geschieht, umso negativer ist in der Regel auch das entsprechende Nationenbild der Menschen (Wanta et al. 2004, vgl. a. Iyengar/Simon 1993). Die Medienabhängigkeit der meisten Menschen wächst mit der Distanz des Publikums zum Weltgeschehen (vgl. a. Kap. 9.2).
Alternative Öffentlichkeitstheorien: „dialogischer“, konstruktiver und kosmopolitischer Journalismus
Was die Frage der innergesellschaftlichen Wirkung und des Kosmopolitismus angeht, so findet sich ein frühes Plädoyer für einen „dialogischen“ Auslandsjournalismus bei Hans Kleinsteuber (2004). Seine Vorstellung eines stärkeren Einbezugs lokaler und kultureller Perspektiven in den Journalismus zielt auf eine Belebung des „Dialogs der Kulturen“. Dieser soll der multikulturellen Gesellschaft neue Impulse verleihen und will die Interdiskursivität verbessern, die nicht mehr vorwiegend auf negative, eliten- und politikorientierte Nachrichten oder stereotype Unterhaltungsware Wert legt, sondern den Vorstellungsraum der interkulturellen Beziehungen erweitern soll. In ähnlicher Weise hat auch Richard C. Stanton auf das Erfordernis eines neuen „Konversationsansatzes“ ( conversational model ) hingewiesen, der das Informationsparadigma des Journalismus ergänzen müsse (2007, S.190ff.). Entscheidend sind demnach nicht mehr nur Nachrichten über elitäres Handeln, sondern die Interessen von Bürgern und der Zivilgesellschaft sollen im Vordergrund stehen.
Читать дальше