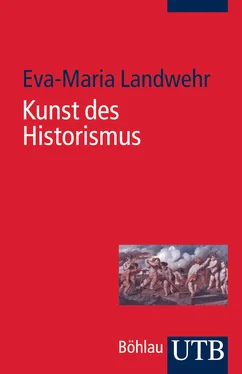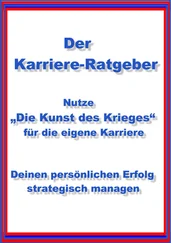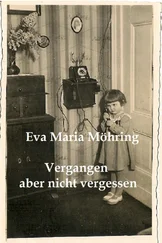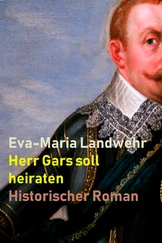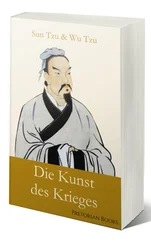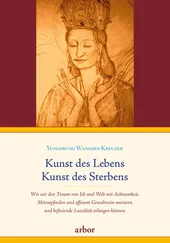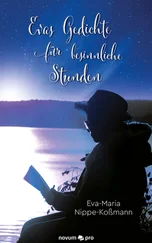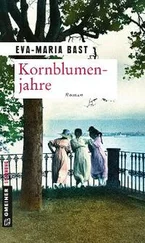Eva-Maria Landwehr - Kunst des Historismus
Здесь есть возможность читать онлайн «Eva-Maria Landwehr - Kunst des Historismus» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kunst des Historismus
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kunst des Historismus: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kunst des Historismus»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kunst des Historismus — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kunst des Historismus», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die zweite Jahrhunderthälfte brachte in Deutschland jedoch die Wende, als die euphorische Aufbruchsstimmung nach der Reichsgründung 1871 alle Bereiche des öffentlichen Lebens bestimmte. Sein Anteil am Wirtschaftswachstum, sein unternehmerischer Wagemut, seine Verdienste um Fortschritt und Technik machten das Bürgertum zur tragenden und damit unverzichtbaren Säule der Gesellschaft und stattete seine Mitglieder mit einem enormen Selbstbewusstsein aus. So behauptete der Architekt Hubert Stier im Jahr 1884, die Fürstenschlösser der deutschen Renaissance hätten schlicht das Bürgerhaus kopiert, selbst das Heidelberger Schloss bestehe im Grunde nur aus einer Gruppierung einzelner imposanter Bürgerhäuser. Der Kunsthistoriker Wilhelm Lübke sah zwei Jahre später in seiner „Geschichte der Architektur“ die größte Errungenschaft der zeitgenössischen Architektur darin, dass im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahrhunderten, in denen Adel und Klerus ihre Prachtbauten in Auftrag gegeben hatten, nun das ganze Volk – damit meinte er die Bürger – Bauherr geworden sei. Im Zentralblatt der Bauverwaltung wurde 1899 noch nachgelegt, indem man darauf verwies, dass Macht und Bildung nun nicht mehr das Prärogativ von Adel und Klerus seien. An deren Position sei das Volk getreten, das seine unterdrückten Rechte nun mit großem Nachdruck beanspruche. Und auch wenn es paradox klingen mag: Trotz der permanenten Konkurrenz mit dem Adel lebte man durchaus zufrieden in einer Untertanengesellschaft, in der ein Adelstitel die Türen öffnete, weshalb die Verleihung eines solchen für viele Bürgerliche ein angestrebtes Karriereziel darstellte. Die Renaissance des
[<<21]
Kaisertums wurde als Vollendung des mittelalterlichen Kaisertums und damit als historischer Auftrag verstanden, der angesichts seiner Tragweite mit dem enttäuschend schwachen Parlamentarismus aussöhnte. In seiner neuen Rolle als gesellschaftliche Führungsschicht sah sich das Bürgertum als Teil dieser historischen Entwicklung, forderte die Teilhabe an deren Realisierung ein und erarbeitete sich seinen eigenen Zugang zur Vergangenheit. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts begann eine argumentative Aufholjagd, um die vergessenen, teils vom Adel usurpiert geglaubten Leistungen des historischen Bürgertums wieder ins gegenwärtige Bewusstsein zu rufen. Wie stark sich Teile der Bürgerschaft vor allem mit der Zeit der deutschen Renaissance als Blütezeit des Bürgertums ganz öffentlich identifizierten, zeigten zum Beispiel historische Festzüge, wie derjenige, der 1879 in Wien im Rahmen der Festlichkeiten angelegentlich der Silberhochzeit des österreichischen Kaiserpaares abgehalten wurde. Die aufwendig kostümierten bürgerlichen Teilnehmer sonnten sich im Glanz der frühneuzeitlichen Bürger-Renaissance und reklamierten damit eine direkte Verbindung zur erfolgreichen Gegenwart ihres Standes. Eine privatere Form der historischen Selbstinszenierung bot die Porträtmalerei – in den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts konnte sich der Münchner Maler Friedrich August von Kaulbach, der Damen des Bürgertums als Patrizierinnen des 16. und 17. Jahrhunderts porträtierte, nicht über einen Mangel an Aufträgen beklagen.
Auch im öffentlichen Raum machte sich dieser Trend bemerkbar: Im Jahr 1818 konnte man in Deutschland weniger als zwanzig öffentliche Standbilder bestaunen – 1883 lief man angesichts von über 800 Denkmälern Gefahr, die Übersicht zu verlieren und lamentierte über die „Denkmalseuche“, ganz so, als wären die einst geschätzten Monumente nun einer lebensbedrohlichen Epidemie vergleichbar. War in den Jahrhunderten zuvor ausschließlich der Adel in den Genuss solcher Würdigungen gekommen, wurde diese Ehre nun auch dem Bürgertum zuteil. Es waren deswegen vor allem von Bürgern ins Leben gerufene Vereine, die die Herstellung von Denkmälern finanzierten und diese aus der schläfrig-entrückten, zeitlosen Sphäre des Landschaftsparks mitten ins Leben holten: in die Stadt. Dieser Umschwung reduzierte die Distanz zwischen Betrachter und Geehrten und bewirkte außerdem, dass die
[<<22]
Geschichte durch die permanente Berührung und den Austausch mit der dynamischen Gegenwart keine Patina ansetzen konnte. An zu Ehrenden bestand kein Mangel, die vergangenen Jahrhunderte hatten schließlich genügend ‚große Söhne‘ bürgerlicher Herkunft hervorgebracht, deren Verdienste auf diese Weise der historischen Identität und Bedeutung der jeweiligen Stadt zugutekamen. Diese Erkenntnis wirkte so beflügelnd, dass noch die unscheinbarste Stadt auf der Suche nach einem geeigneten Individuum in ihrer Vergangenheit fündig werden konnte. Denkmäler für bedeutende Persönlichkeiten der Frühen Neuzeit wie Martin Luther (errichtet 1817 – 21 in Wittenberg) oder Johannes Gutenberg gehörten zu den frühesten Monumenten für Nicht-Adelige. Ihr zentraler Aufstellungsort – oft in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus, dem Symbol bürgerlicher Unabhängigkeit – und ihre dauerhafte Präsenz verhalfen diesen Denkmälern zu einer ganz neuen, intensivierten Perzeption, was von fürstlicher Seite mit Unbehagen registriert und selten gutgeheißen wurde. Als August Hermann Francke, der evangelische Theologe, der Ende des 17. Jahrhunderts in Halle eine umfangreiche Stiftung für Waisenkinder ins Leben gerufen hatte, im Jahr 1828 mit einem Denkmal geehrt werden sollte, das man direkt vor dem Waisenhaus aufzustellen plante, legte König Friedrich Wilhelm III. von Preußen sein Veto ein. Nicht etwa, weil er grundsätzlich gegen eine Würdigung Franckes gewesen wäre, sondern weil ihm der prominente Standort des Monuments vor dem Waisenhaus für eine Zivilperson übertrieben schien – eine Aufstellung in der Abgeschiedenheit des Innenhofes hingegen war für den König akzeptabel. Für die Ausführung der Figurengruppe, die den von zwei Kindern begleiteten Theologen in einem historischen Gewand zeigt, konnte damals Christian Daniel Rauch gewonnen werden; etwas indifferent wirkt jedoch der steinerne Sockel, der anstelle der zu erwartenden antikischen Säulen von Balustern ‚gestützt‘ wird. Der Verzicht auf überlieferte Würdeformeln war eine Konzession an die Empfindlichkeit des Monarchen – zeigt aber zugleich auch das Fehlen einer historisch begründeten bürgerlichen Darstellungstradition.
[<<23]

Abb. 1: Halle/Saale, August Hermann Francke-Denkmal, 1828 (> Abbildungsnachweis)
Einen Adeligen gab es jedoch, der im ausgehenden 19. Jahrhundert uneingeschränkt die Billigung vor allem des wohlhabenden Bürgertums im deutschen Kaiserreich fand: Otto von Bismarck stand für den wirtschaftlichen Aufschwung und die märchenhaften Gewinne der Gründerzeit,
[<<24]
was ihm vor allem in dem Jahrzehnt nach seinem Tod im Jahr 1898 zu über dreihundert, allesamt durch Spenden finanzierten Monumenten, meist in Form von Türmen und Standbildern, verhalf.
Übergang der Institutionen und Architekturtypologien vom Adel auf das Bürgertum
Während die Teilhabe an der Macht schon früh vom Bürgertum eingefordert wurde, war die Teilhabe an der Bildung anfänglich ein Entgegenkommen von adeliger Seite: Geht man auf die Suche nach den Ursprüngen öffentlicher Museen, dann wird man stets bei Sammlungen und Kabinetten des Adels sowie bei fürstlichen Galerien und Wunderkammern fündig werden. Als diese umfangreichen und in ihrer Vielfältigkeit oft sehr heterogenen Kollektionen Ende des 18. Jahrhunderts aus Schloss- oder Residenzkomplexen herausgelöst und in eigenständigen öffentlichen Gebäuden untergebracht wurden, war dies noch keine gesellschaftlich erzwungene Entwicklung, sondern ein zunächst freiwilliges Zugeständnis eines aufgeklärten Teils des Adels, der sich einem humanistischen Bildungsauftrag verpflichtet sah. Am offensichtlichsten wird das pädagogische Moment am Beispiel derjenigen Museen, die in der Bevölkerung ein dezidiert historisches Bewusstsein für das eigene Herkommen begründen sollten. Im Museum Fridericianum in Kassel, das bereits 1779 unter Landgraf Friedrich II. von Hessen vollendet wurde, bezog sich ein Raum zum Beispiel explizit auf Exponate aus der hessischen Geschichte des Mittelalters. Kleinstaaten fiel ein solches Vorgehen ungleich leichter als ganzen Nationen, weshalb es europaweit auch große zeitliche Verschiebungen bezüglich der Einrichtung solcher Museen gab: Während es angesichts einer parlamentarischen Monarchie in England keine Probleme bereitete, bereits im Jahr 1752 die Eröffnung des British Museum zu beschließen, musste Frankreich erst die größten Wirren der Revolution überwinden, bevor 1793 ein Teil des Louvres als öffentliches Kunstmuseum zugänglich gemacht werden konnte. Nach den Befreiungskriegen hatten sich auch in Preußen die Vorzeichen gewandelt: Als 1815 in Berlin die aus Paris restituierten Kunstschätze öffentlich
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kunst des Historismus»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kunst des Historismus» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kunst des Historismus» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.