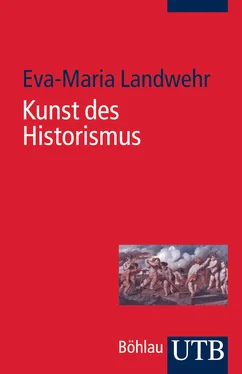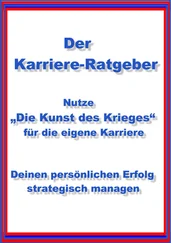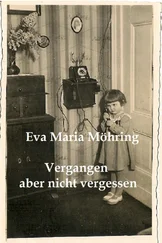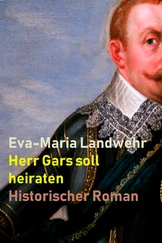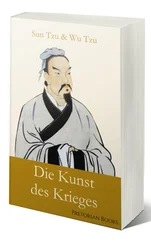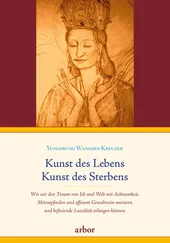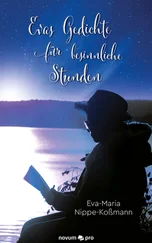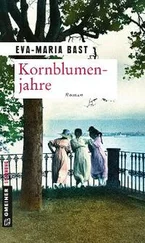Eva-Maria Landwehr - Kunst des Historismus
Здесь есть возможность читать онлайн «Eva-Maria Landwehr - Kunst des Historismus» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kunst des Historismus
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kunst des Historismus: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kunst des Historismus»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kunst des Historismus — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kunst des Historismus», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
[<<17] Seitenzahl der gedruckten Ausgabe
als anlässlich des Leichenzugs dem Katafalk die Arbeiterschaft von über zwanzig Berliner Unternehmen folgte.
Problematisch ist und bleibt aber grundsätzlich, was denn nun eigentlich das Bürgertum war, wer sich dafür ‚qualifizierte‘ und wer durch das gesellschaftliche Raster fiel. Es war nicht das hermetisch abgeschlossene frühneuzeitliche Stadtbürgertum, aus dem das Bürgertum des 19. Jahrhunderts hervorging, es war vielmehr ein liberalisiertes Klima, das Aufsteigern aus den unterschiedlichsten sozialen Gruppen die Chance bot, mit Talent und Leistung auch eine niedrige Herkunft zu relativieren und als Beamte, Unternehmer oder auch Wissenschaftler zu reüssieren. Zuerst jedoch galt es, sich von der biedermeierlichen Privatheit zu befreien, die per se ein außerfamiliäres, öffentlich wirksames Engagement in der Politik oder für die Gesellschaft verhindert hatte. Zwar musste man nach der gescheiterten 1848er-Revolution anerkennen, dass trotz einer Stärkung der Bürgerschaft durch in der Verfassung festgeschriebene Grundrechte ein wirkliches Mitspracherecht auf staatlicher Ebene nicht durchsetzbar war, dass Militärwesen, Verwaltung und Diplomatie weiterhin fest in Adelshand waren. Eine Teilhabe an der Macht auf kommunaler Ebene war jedoch in greifbare Nähe gerückt. Diese gänzlich antirevolutionäre, pragmatische Akzeptanz hinsichtlich einer machbaren Realpolitik erweiterte die Möglichkeiten, die sich dem ‚neuen‘ Bürgertum in Wirtschaft, Handel und Bildung eröffneten. So wurde zum Beispiel um die Jahrhundertmitte die bürgerlich-kommunale Selbstverwaltung durch die Gesetzgebung gestärkt, eine Entwicklung, die sich zeitgleich mit dem Rückzug zahlreicher Fürsten aus ihren Residenzstädten vollzog. Vor allem das schwindende Interesse der fürstlichen Hand an einer fortgesetzten Prägung und Formung des Stadtbildes trug dazu bei, dass den Kommunen zu dieser Zeit auch sukzessive die Verantwortung für das Baurecht übertragen wurde. Zahlreiche Stadtregierungen erkannten das gestalterische Potenzial, das diese Wende mit sich brachte, und gingen dazu über, Grundstücke zu erwerben – in Karlsruhe sogar direkt vom Herrscherhaus selbst. Diese neue Eigenverantwortlichkeit hatte Vor- und Nachteile: Einerseits ruhte die zukünftige Stadtplanung nun auf einem breiteren demokratischen Fundament, andererseits stellte es eine große Herausforderung für die Kommunen dar, neben dem rein
[<<18]
utilitaristischen beziehungsweise funktionalen Teil des Bauvolumens, der ihnen bis zu diesem Zeitpunkt aufoktroyiert worden war, nun auch die Entscheidungen hinsichtlich ästhetischer Fragen zu übernehmen und damit die Freiheit zu haben, ganze Stadtviertel durch Neubaumaßnahmen zu prägen. Zusätzlich bedeutete es eine große Umstellung, bislang autokratisch angeordnete Maßnahmen durch gemeinschaftlich festgesetzte Beschlüsse in den zuständigen Gremien zu ersetzen und damit viele divergierende Interessen und Vorstellungen zu vereinen. Wie wichtig vor allem der persönliche Besitz von städtischem Grund und Boden für eine bürgerliche Existenz war, hatte sich bereits Anfang des 19. Jahrhunderts abgezeichnet, als im Zuge der Steinschen Reformen ein solches Eigentum zur Voraussetzung für die Einflussnahme auf die kommunale Administration wurde. Diese Reformen, die auf der Basis eines größeren Mitspracherechts den Staatsbürger im Untertanen wecken und dadurch verborgene ökonomische Energien freisetzen sollten, hatten den Nachteil, dass Städter ohne Grundbesitz an diesen Verbesserungen schwerlich partizipieren konnten. Eine Revision der Städteordnung stufte dann zwar im Jahr 1831 alle männlichen erwachsenen Stadtbewohner, die über ein gewisses Einkommen verfügten, als wahlberechtigt ein, die faktische Macht blieb jedoch weiterhin in den Händen der Grundbesitzer.
Die bereits erwähnte Rivalität zwischen dem Bürgertum als Herausforderer und dem Adel als Besitzstandswahrer, die während des ganzen 19. Jahrhunderts seine Gültigkeit behielt, manifestierte sich folgerichtig besonders ausgeprägt auf den ‚Schlachtfeldern‘, die von der Perzeption durch eine breite Öffentlichkeit betroffen waren: der Architektur und dem Denkmal. Institutionen der humanistischen Bildung, wie Opern, Theater und Museen, oder auch administrative und infrastrukturelle Bauten, wie Gerichtsgebäude oder Bahnhöfe wurden nicht mehr in erster Linie von Fürsten oder adeligen Mäzenen, sondern von der bürgerlichen Obrigkeit errichtet. Generell änderten sich die Vorzeichen für die Auftragskunst: Die Ausschließlichkeit, mit der Adel und Klerus über Jahrhunderte Aufträge erteilt und das Stiftungswesen genauso wie das Mäzenatentum zu ihren ureigenen Vorrechten und Pflichten erklärt hatten, wurde vom Bürgertum beherzt und erfolgreich angefochten. Mit der Gründung von Kunstvereinen, einer Entwicklung, die schon
[<<19]
kurz nach den Befreiungskriegen einsetzte, wandte man sich von bürgerlicher Seite gegen das Kunst- und Auftraggeber-Monopol des Adels. Man wollte den bürgerlichen Künstler durch Spenden und Stiftungen gewissermaßen aus den eigenen Reihen heraus fördern, damit die Kunst, so der Frankfurter Kunstverein im Jahr 1829 expressis verbis, nicht mehr „den Höfen dienen“ müsse (Roth 1996, Zitat S. 129f.). Eine solche Entwicklung musste entsprechende Gegenmaßnahmen provozieren, die sich unter anderem auch auf historische Künstlerpersönlichkeiten bezogen, die von bürgerlicher und adeliger Seite gleichermaßen vereinnahmt wurden: Die Stadt Nürnberg zum Beispiel hatte ihr reichsstädtisches Selbstbewusstsein über alle Zeitläufte hinweg bewahrt und galt deswegen bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Paradebeispiel für lebendigen Bürgerstolz. Die Verehrung für Albrecht Dürer, den deutschen Maler und Renaissance-Menschen schlechthin, war stets wachgehalten worden: Neben den zeitgenössischen Künstlern sah sich anlässlich der anstehenden Feiern zu Dürers 400. Geburtstag auch das Bürgertum in der Pflicht, die historischen Verdienste des Künstlers zu würdigen. Eine solche drohende Vereinnahmung Dürers als Künstler des Bürgertums konnte König Ludwig I. von Bayern nicht dulden und intervenierte mit einer großzügigen Spende für ein Denkmal zu Ehren des Künstlers, um durch diese fürstliche Geste die öffentliche Aufmerksamkeit auf Nürnberg als Kaiserstadt und Dürer als kaiserlichen Hofmaler zu lenken. Die Nürnberger jedoch durchschauten die Absicht und waren verstimmt – die Dankesreden an die Adresse des Königs anlässlich der Denkmalseinweihung waren dementsprechend zurückhaltend formuliert (Kosfeld 1992).
Auch für sein Privathaus forderte der Bürger nun den Zugriff auf eine Architekturtypologie und auf eine Formenwelt, die über Jahrhunderte Adel und Klerus vorbehalten gewesen war. Noch in der ersten Jahrhunderthälfte aber waren bürgerliche Ansinnen, mithilfe der Baukunst und des sie unterstützenden ikonographischen Zeichensystems adeliges Leben und Wohnen zu kopieren, mit Ironie und Häme beantwortet worden. Der Maler Adolph Menzel zum Beispiel mokierte sich im Jahr 1841 darüber, dass es ein Problem sei, dass Menschen gerne mehr darstellen wollten, als sie tatsächlich seien. So fände es ein Metzger wohl nicht amüsant, wenn der Architekt sein Haus mit Attributen verzierte, die auf seinen
[<<20]
Berufsstand schließen ließen – der Metzger wolle vielmehr, dass sich die Passanten ehrfürchtig fragten, ob das schöne Haus einem Adeligen gehöre. In England wurde gesellschaftlichen Aufsteigern der Weg zu einem gehobenen Lebensstil in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht annähernd so schwer gemacht. Ganz im Gegenteil gehörten diese Persönlichkeiten als respektierte Leistungsträger einer frühindustrialisierten Gesellschaft zur wichtigsten Architekten-Klientel. Anders als der Geldadel auf dem Kontinent hatten sich diese Unternehmer selbstbewusst aus den Zwängen des von der Aristokratie geprägten ästhetischen Kanons befreit und nahmen sich unbekümmert, was ihnen am Stilrepertoire gefiel: sei es klassisch, gotisch – oder auch nur eine phantasievolle Mixtur aus allem.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kunst des Historismus»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kunst des Historismus» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kunst des Historismus» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.