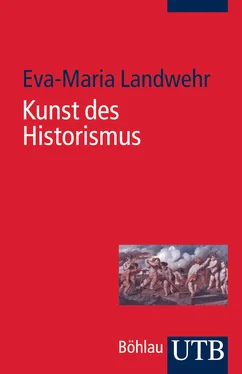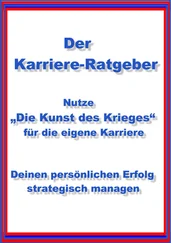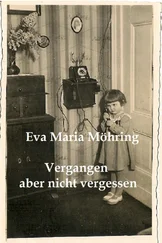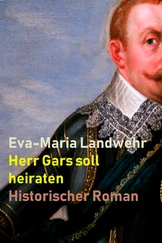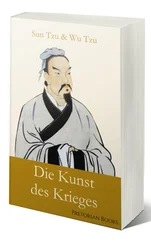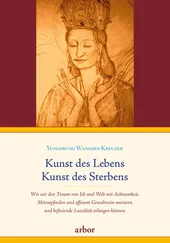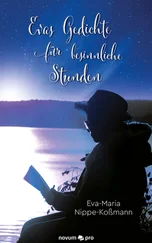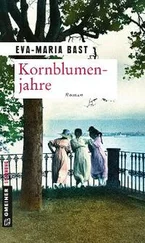Eva-Maria Landwehr - Kunst des Historismus
Здесь есть возможность читать онлайн «Eva-Maria Landwehr - Kunst des Historismus» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kunst des Historismus
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kunst des Historismus: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kunst des Historismus»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kunst des Historismus — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kunst des Historismus», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
So weckte der Zugriff auf die Vergangenheit im Bürgertum des 19. Jahrhunderts keine wirklich neuen Wünsche, sondern erfüllte bereits lange Zeit latent vorhandene Sehnsüchte nach einer gehobenen Form von Zugehörigkeit. Zwar herrschte im 19. Jahrhundert ein nach wie vor ausgeprägtes Klassenbewusstsein, doch die gesellschaftlichen Membranen waren partiell durchlässig geworden und machten dadurch individuelle Lebensentwürfe grundsätzlich umsetzbarer. Dieser neugewonnene gesellschaftliche Radius erweiterte auch den kulturellen Spielraum des Individuums.
Die Konkurrenz und die Bedrohung, die von der neuen bürgerlichen Wahlfreiheit ausgingen, waren deutliche Warnsignale für den Adel: Historisch ‚saturiert‘ war er wohl in seinem klassenspezifischen, nicht aber in seinem traditionellen Selbstverständnis erschüttert. Sich neu zu erfinden lag der Aristokratie fern, sie vertraute vielmehr auf die Konservierung des verbliebenen Ansehens, welches die Existenzberechtigung und Attraktivität des Adelsstandes erhalten und für die Zukunft bewahren helfen sollte. Die Pfunde, mit denen der Adel bei seinem Bemühen um Statussicherung wuchern konnte, waren unbestreitbar seine spezifische Familientradition, seine beeindruckende genealogische und historische Verwurzelung, sein kulturelles Mäzenatentum und – für jedermann
[<<12]
sichtbar – seine architektonischen Hinterlassenschaften in Form von Burgen und Schlössern.
Die Nation wiederum zählte zu den größten Errungenschaften des 19. Jahrhunderts. Getragen vom Gedanken an eine verbindende, miteinander geteilte Identität auf der Basis einer gemeinsamen Vergangenheit, präsentierte sich dieses Jahrhundert als eine Epoche der sich konstituierenden Nationalstaaten. Die Geschichte erwies sich als das stärkste Bindemittel für die Einigung meist heterogener ethnischer Gruppen unter dem Dach der Nation: Um wirkmächtig zu werden, musste der Einheitsgedanke von einer breiten Öffentlichkeit getragen werden, an deren nationale Gefühlswelt bevorzugt durch monumentale Denkmäler mit historischem Bezug und historisierender Gestaltung appelliert wurde.
Die Kirche beziehungsweise die führenden Religionsgemeinschaften fanden sich nach der Säkularisation und später nach dem Kulturkampf bedrohlichen Modernisierungsprozessen ausgesetzt. Während sich die Katholiken durch einen autoritären, antiliberalen Konservativismus zu schützen suchten, profitierten die Protestanten vordergründig von der Etablierung des protestantischen Kaisertums unter preußischer Führung – Probleme mit der fortschreitenden Entkirchlichung des Lebens hatten jedoch beide Konfessionen, während das Judentum sich nicht eindeutig durchringen konnte, zwischen Assimilationsbereitschaft und Autonomiestreben zu wählen. Offensive Strategien wurden notwendig, um das verlorene Vertrauen in die Religion wiederzugewinnen – aufgrund der großen Assoziationsmöglichkeiten bot der Einsatz historischer Stile im Kirchenbau architektonische Lösungen an, die der alten Liturgie ein Gehäuse neu belebter Frömmigkeit verschaffen sollten.
Sowohl in der Theorie der Künste als auch in der Praxis eröffnete das 19. Jahrhundert den bauenden und gestaltenden Berufen gänzlich neue Erkenntniswelten und stellte damit deutlich erhöhte Forderungen an deren Flexibilität und Innovationsbereitschaft. So schuf die empirische, in der Tiefe als auch in der Breite des Gegenstandes ganz neu dimensionierte, geisteswissenschaftliche Aufarbeitung der Stilepochen eine unverzichtbare Grundlage für ein fundiertes und rational erfasstes historistisches Entwerfen. Zusätzlich revolutionierten technische und materialbezogene Neuerungen ebenso wie ausbildungsbezogene Umstrukturierungen die
[<<13]
akademische und praktische Welt der Kunstschaffenden und Kunstrezipienten gleichermaßen.
Die Frage nach der Motivation, einen ganz bestimmten Stil zu rezipieren und für die Gegenwart zu adaptieren, ist mit Sicherheit problematisch. Steht der heutige Betrachter vor einer semantischen Kunst, die von den konfessionellen, gesellschaftlichen und auch politischen Gegebenheiten ihrer Entstehungszeit erzählt? Oder ist das 19. Jahrhundert eine Epoche der beliebig reanimierten, rein dekorativ eingesetzten Neostile? Hinter jeder neugotischen Kirche eine ikonologische Botschaft zu vermuten, wäre ebenso vermessen, wie diese – wahrhaft zahlreichen Sakralbauten – in ihrer Gesamtheit als seelenlose Massenware zu deklarieren.
Zweifellos aber sind die Zusammenhänge von Historismen in der Kunst mit zeitgenössischen Problematiken und Ideologien unbestreitbar. Es gilt also, Einzelfälle mit einem geschärften Blick zu betrachten und darzustellen, auf welche Weise und in welchem Umfang historische Stile für die Kunst des 19. Jahrhunderts und damit im Interesse ihrer Rezipienten instrumentalisiert wurden. Eine systematische Aufgliederung in Auftraggeber-Gruppen beziehungsweise Trägerschichten versucht der gesellschaftlichen Bedeutung des Themas gerecht zu werden und vor allem die Wahl des für die jeweilige ‚Botschaft‘ geeigneten Stils transparenter und verständlicher zu machen. Eine Gewichtung der vorgestellten Beispiele zugunsten der Gattungen Architektur und Denkmal ergab sich aus der öffentlichen Präsenz und Sichtbarkeit dieser Monumente, deren narratives Potenzial naturgemäß größer ist als dies bei Kunstwerken möglich wäre, die ausschließlich für einen eng begrenzten Rezipientenkreis geschaffen wurden. Zu den Zwängen, denen eine knappe Übersichtsdarstellung wie die vorliegende unterworfen ist, gehört auch die Notwendigkeit, aus Platzgründen auf eine enzyklopädische Behandlung des Themas zu verzichten. Für die Architektur bedeutet das zum Beispiel, dass Bauten wie Parlamente oder auch Gerichtsgebäude zugunsten anderer funktionaler Gebäudetypen nicht berücksichtigt werden konnten.
[<<14]
Literatur
Bringmann 1968; Brix / Steinhauser Geschichte im Dienst 1978; Csàky 1996; Döhmer 1976; Driever 2001; Frevert / Haupt 2004; Friedell 1996; Gaethgens / Fleckner 1996; Hardtwig 1978; Klingenburg Nachdenken über Historismus 1985; Klotz 2000; München und seine Bauten 1912; Pevsner 1965; Schroers 1896; Selle 2007; Soane 2007; Wehler 1995
[<<15]
2.  Bürgertum: Stil für alle
Bürgertum: Stil für alle
Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Bürgertums. Sein Aufstieg ist ohne den Antagonismus zum Adel weder denkbar noch erklärbar, denn was der Adel an Ansehen, Macht und Privilegien verlor oder besser: was ihm genommen wurde, das eroberte sich Schritt für Schritt das Bürgertum. Während sich der Adel zu oft in der reinen Besitzstandswahrung erschöpfte und darüber zusehends in eine Art Lethargie verfiel, berauschten sich die Bürger an ihrer eigenen Erfolgsgeschichte. Das Prinzip der Ständegesellschaft, in der ein gesellschaftlicher Aufstieg ausschließlich über die Abstammung sanktioniert gewesen war, wurde im 19. Jahrhundert von einem bürgerlichen Gesellschaftskonzept abgelöst, das mit der Zeit immer mehr Statusverbesserungen zuließ. Selbstverständlich war das Bürgertum keine homogene Bevölkerungsgruppe, die in einer Atmosphäre politischer, gesellschaftlicher und sozialer Gleichheit, wie sie in den idealistischen Vorstellungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts existierte, hätte gedeihen können. Man hatte von den Gesetzmäßigkeiten der Adels-Hierarchie gelernt und so gab es innerhalb der bürgerlichen Schichten natürlich weiterhin ein Oben und ein Unten, Gewinner und Verlierer – und damit die obligatorischen Friktionen zwischen einer bürgerlichen Elite mit Führungsanspruch und einer Vorstellung vom Bürgertum, die nach wie vor einem egalitär ausgerichteten Miteinander anhing. Auch wenn man sich gegen die Restauration feudaler Zustände stemmte, wurden Erfolg und Status, die kraft eigener Leistung erreicht wurden, akzeptiert und mit Loyalität belohnt. Der Berliner Unternehmer August Borsig war in dieser Hinsicht ein ‚Selfmade-Fürst‘, der sich sein Imperium nicht durch Erbe, sondern auf der Basis eigener Hände Arbeit geschaffen hatte und verantwortungsvoll für seine ‚Untertanen‘ sorgte. Als er 1854 starb, wurde ihm diese Haltung mit einer wahrhaft fürstlichen Bestattung vergolten,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kunst des Historismus»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kunst des Historismus» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kunst des Historismus» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.