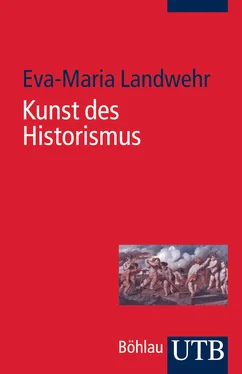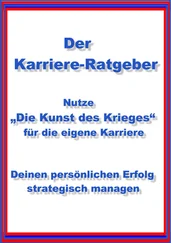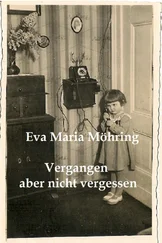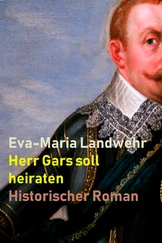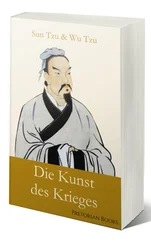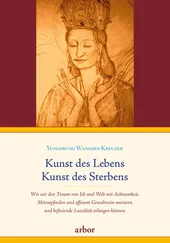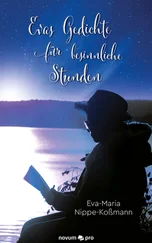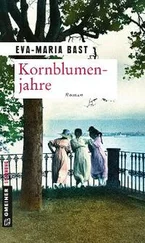Eva-Maria Landwehr - Kunst des Historismus
Здесь есть возможность читать онлайн «Eva-Maria Landwehr - Kunst des Historismus» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kunst des Historismus
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kunst des Historismus: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kunst des Historismus»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kunst des Historismus — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kunst des Historismus», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
[<<40]
In Stuttgart hingegen laborierte man bereits seit den Siebzigerjahren an einem Neubau und vor allem an dessen Standort, da das alte, im Kern mittelalterliche Rathaus der aktuellen Stadtverwaltung nicht mehr ausreichend Raum bot. Lange wurde um einen Abriss der historischen Bausubstanz gerungen und schließlich trotz einiger Bedenken durchgesetzt, weil ein Neubau nur am zentralsten und damit hierarchisch obersten Standort vollstellbar war – nur an diesem repräsentativen Platz war eine überzeugende Demonstration bürgerlichen Machtanspruchs möglich. Für den von 1898 bis 1905 von Heinrich Jassoy und Johannes Vollmer errichteten Rathausneubau wurden schließlich spätgotische Formen gewählt, interessanterweise unter spolienartiger Integrierung einzelner Teile des alten Rathauses, wie zum Beispiel der historischen Kapelle. Auch wenn der Schwerpunkt der Ausstattung auf Themen der bürgerlichen Ikonographie lag, wurde der württembergischen Monarchie durch die Aufstellung von Denkmälern für König Wilhelm I. und König Wilhelm II. ausreichend Respekt gezollt.
War das Rathaus des 19. Jahrhunderts fertiggestellt, bot die Ausstattung der Räumlichkeiten durch Mobiliar und wertvolle zeremonielle Gebrauchsgegenstände weitere Möglichkeiten, es dem Bürgertum der Vergangenheit gleichzutun, wie zum Beispiel mit der Anschaffung eines neuen oder in der Aufstockung eines bestehenden Ratssilbers. Ratssilber, das waren und sind vielteilige, kostbare Tafelgeschirre, die seit dem späten Mittelalter zur Ausstattung von Rathäusern wohlhabender Städte gehörten. Durch ihren Einsatz bei festlichen Anlässen hatten sie in erster Linie repräsentativen Charakter, sie gehörten aber auch zu den städtischen Notreserven und mussten deshalb im Lauf der Jahrhunderte nicht selten verkauft oder eingeschmolzen werden. Vor allem der wirtschaftliche Aufschwung der Gründerjahre machte es prosperierenden Städten möglich, oft auch in Verbindung mit einem Neubau des Rathauses, in Ratssilber zu investieren – allein Köln zum Beispiel gab ein 900-teiliges Tafelsilber in Auftrag. Finanziert durch Spenden und Stiftungen betuchter Bürger sollte das Ratssilber des 19. Jahrhunderts ein Beleg für Generosität und Gemeinsinn und damit das Aushängeschild für das Erfolgsmodell der autonomen neuzeitlichen Stadt sein.
[<<41]
Ein Aufgabenbereich der Kommunalverwaltung prägte das soziale Miteinander des städtischen Bürgertums in besonders hohem Maße und war angesichts der Zuwanderung und des Bevölkerungswachstums von existenzieller Bedeutung: das Fürsorgewesen. Ende des 19. Jahrhunderts hatte das Wohlfahrtswesen in München, der Hauptstadt des bayerischen Königreiches, einen vergleichsweise hohen Standard erreicht, der vor allem dem regen Engagement der verantwortlichen kommunalen Stellen geschuldet war. Der letzte König aus dem Haus Wittelsbach, Ludwig II., war 1886 gestorben, Luitpold, der Onkel des Königs, hatte die Amtsgeschäfte als Prinzregent übernommen. Das so entstandene Vakuum in der Monarchie füllten die Stadtväter, die darin eine Chance sahen, sich als bürgerliche Auftraggeber in einer direkten Nachfolge frühneuzeitlicher fürstlicher Fürsorgepflicht durch Bauten karitativer Ausrichtung zu profilieren. Den Anfang hatte das städtische Kinderasyl gemacht, ein schlossähnlicher, rechteckiger Bau mit einem übergiebelten Mittelrisalit und von Wandpilastern gerahmten Seitenrisaliten, der bereits 1888/89 im Stil des späten 18. Jahrhunderts erbaut worden war. Als in den Jahren 1892 – 94 der Bau des Armenversorgungshauses St. Martin in Giesing durch Karl Hocheder erfolgte und schnell deutlich wurde, dass diese Institution angesichts der unzumutbaren Zustände in den bestehenden Armenhäusern eine wegweisende Bedeutung für die künftige Armenfürsorge haben sollte, war dies ein klares Bekenntnis der Stadt München zu ihrer sozialen Verantwortung. Äußerlich einem wohlhabenden Kloster des 18. Jahrhunderts verblüffend ähnlich, scheint der architekturikonologische Bezug zum Armenhaus teilweise überzeugend, hatten doch Klöster – nicht nur in der Frühen Neuzeit – immer auch karitative Funktionen übernommen.
Ein zeitbezogen weitaus angemessenerer, schlichterer Bau wäre auch kaum den Intentionen der Bauherren entgegengekommen, die ihren Gemeinsinn und ihre tätige ‚Caritas‘ lieber in einem repräsentativen Rahmen inszeniert sehen wollten. Die so entstandene, paradox erscheinende Diskrepanz zwischen der prächtigen Außenhaut und dem doch sehr eingeschränkten Komfort der Bewohner schien die zeitgenössische Kritik nicht weiter zu irritieren: Ganz im Gegenteil wurden die Parallelen von aktueller Armenfürsorge und entbehrungsreicher, klösterlicher Existenz als augenfälliges historisches Bindeglied zur Gegenwart betrachtet.
[<<42]

Abb. 4: München-Giesing, Armenversorgungshaus St. Martin, 1892 – 1894 (zerstört) (> Abbildungsnachweis)
Das Städtische Waisenhaus in Neuhausen, 1896 – 99 von Hans Grässel wiederum im Barockstil erbaut, galt mit seinem eindeutigen architektonischen Bezug zu Schloss Nymphenburg als Prestigeobjekt der Stadtoberen, das sich nun nicht mehr mit einem fürstlichen Wappen, sondern mit dem Münchner Kindl über dem Portal als bürgerlich-städtische Stiftung auswies.
[<<43]
Technik trifft auf Tradition: die Eisenbahn
Nachdem in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts die erste dampfbetriebene Eisenbahn noch in gemächlichem Tempo über die Gleise gerollt war, setzte sich diese neue Fortbewegungstechnik in Amerika wie auch in Europa mit atemberaubender Geschwindigkeit durch. Auf deutschem Boden entwickelte sich aus dem Pionierprojekt der 1835 gegründeten Eisenbahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth sukzessive ein kleines Netz meist privat finanzierter Städteverbindungen. Als das immense Potenzial dieser neuen Art des Reisens und des Transports offenkundig wurde, war der preußische Staat schnell bei der Hand und leitete bereits 1850 einen Verstaatlichungsprozess ein, der dreißig Jahre später zu einem reinen Staatsbahnsystem führen sollte. In Frankreich wiederum entstanden während dieser Jahrzehnte mächtige Eisenbahngesellschaften, die zu den ersten wirklich großen modernen Unternehmen der Neuzeit gerechnet werden müssen. Der ökonomische Erfolg stellte sich spätestens dann ein, wenn, wie in Frankreich, der mühevolle Ausbau des Eisenbahnnetzes durch die sinnvolle Verknüpfung aller Einzelstrecken und Bahnhöfe beendet war und zeitintensive, unweigerlich über ein bestimmtes Zentrum führende Reisen effektiv verkürzt werden konnten.
Sowohl die Eisenbahn als Maschine als auch ihre Gebäude, die Bahnhöfe, waren Errungenschaften allein des 19. Jahrhunderts und damit ohne jegliche historische Vorbilder. Es gab keine überlieferte Architekturtypologie, keine tradierte Ikonographie, die man in der Gegenwart für diese Zwecke hätte adaptieren können. Am Anfang stand deshalb der konventionelle steinerne Bahnhof, der eine meist eingleisige Bahnstrecke bediente – die voranschreitende Expansion des Eisenbahnnetzes führte jedoch dazu, dass so manches frühe Bahnhofsgebäude bereits nach wenigen Jahrzehnten einem Neubau weichen musste. Solche Neubauten entwickelten sich dann bald zu mit Eisen und Glas überwölbten Hallen, die alle Gleise unter einem weit gespannten Dach bündeln konnten. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass diejenigen Bereiche, in denen sich das wartende Publikum aufhielt, sich ausruhte oder einen Imbiss zu sich nahm, stets in konventioneller Bauweise errichtet waren, also das vertraute,
[<<44]
menschliche Maß zu beschwören suchten. Die alle bisherigen Höhendimensionen sprengende Gleishalle war dagegen ein angemessener ‚Stall‘ für das ‚Feuerross‘ – wie die Lokomotive anfänglich so ehrfurchtsvoll und zugleich poetisch bezeichnet wurde –, dessen Dampf sich in der schwindelnden Höhe der riesenhaften eisernen Bogenkonstruktion verlieren konnte. Auch der Kölner Hauptbahnhof aus der Mitte des 19. Jahrhunderts musste ab 1889 einem Neubau dieser Art weichen und konnte dann mit einer Besonderheit beeindrucken: Das Wartesaalgebäude in Form eines konventionellen Pavillons wurde zum Gebäude im Gebäude, indem man es direkt in die Perronhalle aus Eisen und Glas hineinpflanzte. Die Überlegenheit der neuen Technik triumphierte vordergründig sichtbar über die traditionelle Bauweise, aber eigentlich handelte es sich gewissermaßen um ein Experiment im Gewächshaus: Weil der Wartesaal von außen nicht sichtbar war, konnte an ihm materiell und stilistisch mittels einer neuartigen Bauweise aus Eisenfachwerk mit glasierten Terrakotten experimentiert werden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kunst des Historismus»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kunst des Historismus» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kunst des Historismus» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.