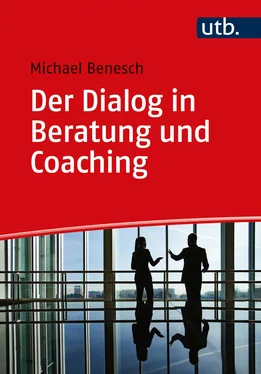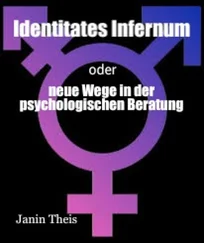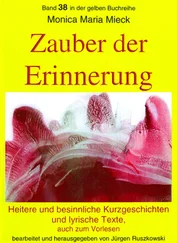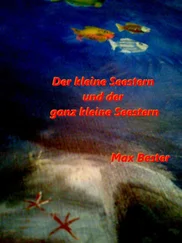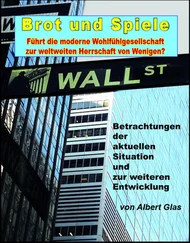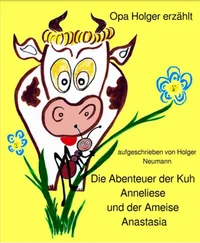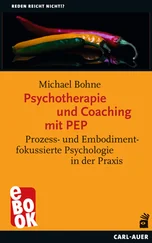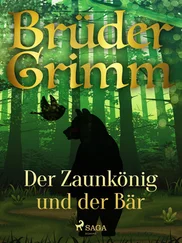Auch das Ergebnis eines scheinbar einfachen Denkprodukts ist als die Synthese vielfacher, komplexer und sehr persönlicher Beziehungserfahrungen und -konstruktionen aufzufassen, die großteils auf Ebenen unterhalb unserer bewussten Wahrnehmung ablaufen.
Und selbstverständlich dürfen wir dabei den Kontext, im Rahmen dessen wir unbewusst an unseren Konstruktionen arbeiten, nicht außer Acht lassen. Beängstigend sind die Umstände des Falls Uzal Ent, die während des Zweiten Weltkriegs zu einem Flugzeugunfall führten und einen Menschen in den Rollstuhl zwangen. Dem berühmten und geachteten Luftwaffengeneral war im Oktober 1944 ein Ersatzpilot zugeteilt worden. „Während des Starts begann Ent in seinem Kopf eine Melodie zu singen und dazu von Zeit zu Zeit mit dem Kopf zu nicken. Der neue Kopilot deutete diese Geste als Zeichen, die Räder einzuziehen. Obwohl sie zum Abheben noch viel zu langsam waren, zog er das Fahrwerk ein, was dazu führte, dass das Flugzeug unsanft zu Boden ging. Dabei löste sich ein Propeller und verletzte Ent so schwer im Rücken, dass er von da an beidseitig gelähmt war“ (Cialdini 2001, S. 30).
Natürlich war das Verhalten des Kopiloten dumm. Aber es wäre zu einfach, dies als einzige Erklärung anzuführen. Der Kontext, die zugestandene Autorität des Generals, beeinflusste mit Sicherheit das Verhalten und die Wahrnehmung des Ersatzpiloten, und zwar auf einer unbewussten Ebene, denn sonst hätte der Mann nicht so unverständlich reagieren können. Wahrgenommene Autorität erzeugt in vielen Menschen ein mentales Modell der Art: „Die Ansicht einer Autoritätsperson wird hoch bewertet, die Gültigkeit der eigenen Meinung schrumpft.“ Selbstverständlich bieten sich gerade bei diesem Beispiel noch weitere Erklärungsmodelle an, wie beispielsweise das Phänomen der Autoritätshörigkeit an sich. 14Aber das Uzal-Ent-Muster zeigt doch eindrucksvoll, wohin uns unbewusste mentale Modelle sogar auf einer konkreten Handlungsebene führen können. Sie vermögen Denkweisen und Handlungen in uns aufkommen zu lassen, die sich in einem anderen Kontext niemals zeigen würden.
Kontextuale Effekte wie der eben beschriebene sind wohlbekannt und untersucht. Sehen wir uns noch ein dialogtypischeres Beispiel aus dem Bereich der Sozialpsychologiean, welches zeigt, wie mächtig unsere unbewussten Konstruktionen sind, symbolisch gesprochen: jene Auffüllungen der weißen Flächen zwischen den drei schwarzen Kreisen, die uns ein Dreieck vorgaukeln (siehe Abb. 4):
Personen wurden aufgrund der Ergebnisse aus einer Selbstbeurteilungsskala in zwei Gruppen eingeteilt (Gerrig/Zimbardo 2008, S. 654):
a) höchstens schwache Vorurteile gegenüber Afroamerikanern,
b) starke Vorurteile gegenüber Afroamerikanern.
Danach wurden ihnen Fotografien vorgelegt, die Schwarze oder Weiße mit einem entweder glücklichen oder wütenden Gesichtsausdruck zeigten, und die Versuchspersonen mussten angeben, ob sie mit dieser Person gerne zusammenarbeiten würden. Die Fotos wurden angekündigt (zum Beispiel: wütend/weiß, glücklich/schwarz) und zusätzlich wurde während dieser Phase der Ankündigung die Gehirnaktivität gemessen. Die Messungen ergaben, dass sich die Hirnaktivitätsmuster deutlich unterschieden. Versuchspersonen mit schwachen Vorurteilen aktivierten Denkressourcen, um jedes Gesicht individuell zu beurteilen, während die Personen mit starken Vorurteilen weniger Gehirnarbeit leisteten und relativ schnell „Nein, ich würde mit dieser Person nicht zusammenarbeiten wollen“ antworteten.
Warum sollten wir uns mit derartigen Phänomenen beschäftigen? Im Dialog verfolgen wir ja den Anspruch, uns des eigenen Denkens bewusster zu werden, das eigene Denken zu beobachten. Je öfter wir etwas tun, je öfter wir etwas denken, desto stärker wird genau dieses zu einer unreflektierten Gewohnheit. Man könnte sagen: Es entstehen neuronale Signaturen, Muster im Gehirn, die nicht mehr hinterfragt werden.
Wie binden Sie eigentlich Ihre Schnürsenkel? Versuchen Sie einmal, diese Bewegungsabläufe genau zu beschreiben, ohne es zu tun – nur in Gedanken. Vermutlich wird Ihnen das nicht leichtfallen, obwohl Sie es schon tausende Male gemacht haben.
David Bohm meint dazu (Bohm 2007, S. 14):
„I think that whenever we repeat something it gradually becomes a habit, and we get less aware of it. If you brush your teeth every morning, you probably hardly notice how you’re doing it. It just goes by itself. Our thought does the same thing, and so do our feelings. That’s a key point.“
Und weiter:
„When you are thinking something, you have the feeling that the thoughts do nothing except inform you the way things are and then you choose to do something and you do it. That’s what people generally assume. But actually, the way you think determines the way you’re going to do things. Then you don’t notice a result comes back, or you don’t see it as a result of what you’ve done, or even less do you see it as a result of how you were thinking“ (ebd., S. 16).
Wir können also von einem Fehler im Denken sprechen: Das Denken informiert uns nicht über die Probleme „da draußen“, das Denken selbst bestimmt bzw. konstruiert das, was wir Probleme nennen, und das gilt natürlich ebenso für die Gesamtwahrnehmung. Deshalb müssen wir unser Denken selbst beobachten. Wir haben immer unzureichende Informationen, wenn es darum geht, Situationen, Menschen oder uns selbst zu beurteilen. Aber wie füllt unser Denken die weißen Stellen auf? Mit welchen Vorannahmen geschieht es? Welche unserer Filter wirken in welcher Weise dabei mit? Das alles sind äußerst individuelle Prozesse, denn schließlich passiert es ja, dass der eine dort überhaupt keine Probleme wahrnimmt, wo ein anderer viele sieht. Wir sind in einer Art Zirkel gefangen, die Katze beißt sich in ihren eigenen Schwanz: Wir können mithilfe unseres selbst produzierten Denkens innerhalb unseres Denkapparates nur das zu beobachten versuchen, was eben dieser Denkapparat wiederum selbst hervorbringt.
Bereits der antike griechische Philosoph Epiktetreflektierte dieses Problem, als er meinte, dass es nicht die Dinge an sich sind, die uns ängstigen, sondern unsere Einstellung den Dingen gegenüber. Wie sonst könnte es sein, dass jemand hyperventiliert und umkippt, sobald er eine Kreuzspinne sieht, ein anderer aber dicke, fette Vogelspinnen richtiggehend gernhat und sie sich auf die Hand setzt?
Heinz von Förstersprach von einem unglaublichen Wunder, das hier stattfindet (von Förster/Pörksen 2006, S. 16):
„Alles lebt, es spielt Musik, man sieht Farben, erfährt Wärme oder Kälte, riecht Blumen oder Abgase, erlebt eine Vielzahl von Empfindungen. Aber all dies sind konstruierte Relationen, sie kommen nicht von außen, sie entstehen im Innern. Wenn man so will, ist die physikalische Ursache des Hörens von Musik, daß einige Moleküle in der Luft ein bißchen langsamer und andere ein bißchen schneller auf das Trommelfell platzen. Das nennt man dann Musik. Die Farbwahrnehmung entsteht in der Retina; einzelne Zellgruppen errechnen hier, wie ich sagen würde, die Empfindung der Farbe. Was von der Außenwelt ins Innere gelangt, sind elektromagnetische Wellen, die auf der Retina einen Reiz auslösen und im Falle von bestimmten Konfigurationen zur Farbwahrnehmung führen.“
Diese Phänomene des Erkennens sind selbstverständlich nicht nur auf physikalische Wahrnehmungen wie die eben beschriebenen beschränkt. Sie beziehen sich auf alles, was wir tun. „In diesem Sinn werden wir ständig festzustellen haben, dass man das Phänomen des Erkennens nicht so auffassen kann, als gäbe es ,Tatsachen‘ und Objekte da draußen, die man nur aufzugreifen und in den Kopf hineinzutun habe. […] Die Erfahrung von jedem Ding ,da draußen‘ wird auf eine spezifische Weise durch die menschliche Struktur konfiguriert, welche ,das Ding‘, das in der Beschreibung entsteht, erst möglich macht“ (Maturana/Varela 1987, S. 31).
Читать дальше