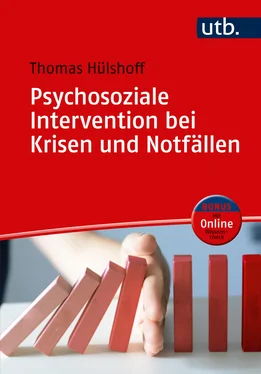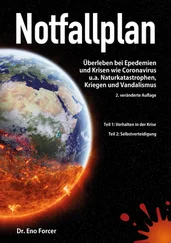Distanzierung und Selbstberuhigung
Es gibt zahlreiche Strategien zur Distanzierung und Selbstberuhigung wie beispielsweise Atemübungen, Körperübungen, Techniken zur Ablenkung usw., deren Anwendung allerdings eine intensive pädagogische Ausbildung und vor allem die angemessene Berücksichtigung des situativen Kontextes sowie der biographischen Vorerfahrung der Jugendlichen bedarf. Dies gilt auch für das Einüben bestimmter Ressourcen bzw. Skills, die es dem Jugendlichen ermöglichen, trotz und mit seiner immer wieder auftretenden Schwierigkeiten eine angemessene kognitive, emotionale und insbesondere soziale Entwicklung zu nehmen.
Alltags-Skills
Alltags-Skills (Geschirr abwaschen, Körperpflege, Ernährung, Auseinandersetzung in Gruppen) sind Aufgaben aller Jugendlichen, können aber beim Vorliegen eines posttraumatischen Belastungssyndroms erheblich erschwert sein. So kommt dem Krisenmanagement und der Unterstützung von Stressregulation eine besondere Bedeutung zu. Hierbei ist es notwendig, komplexe Flashback-Situationen mit Dissoziation, körperlicher Erregung, Erstarrung etc. zunächst einmal überhaupt zu erkennen und sodann durch eine gezielte Kontaktaufnahme, Aktivierung der Reorientierungskräfte, gezielte Aufklärung und Kontaktregulation dem Betroffenen zu helfen, diese schockähnliche Flashback-Situation zu bewältigen. Hierzu gibt es inzwischen gut elaborierte, sehr praxisnahe Handlungsanweisungen.
Diese und andere Überlegungen der pädagogischen Begleitung (oft über viele Jahre) ermöglichen es, dass das Gehirn unter diesen Sicherheit gebenden strukturellen und beziehungsdynamischen Gegebenheiten neue und dauerhafte Erfahrungen macht, die letztlich zu einer neuen Vernetzung neuronaler Bahnen führt. Dies geschieht top down, d. h., die präfrontale Kortex analysiert, dass Stressoren nicht unbedingt die gleiche potenzielle Gefährdung wie das damalige Trauma haben müssen und dass es andere, abgestufte und komplexere Möglichkeiten der Problembewältigung als die damals im akuten Stress gelernten gibt. Erst nach langjähriger Habituation werden die archaischen Reaktionen (völliges Überrollt-Werden von Gefühlen, Bearbeitung durch Stamm- und Zwischenhirn mit Flight-, Fight- and Freeze-Reaktion, Flashbacks und Intrusion) an Frequenz und Intensität zugunsten adäquaterer Reaktionsmuster und Problemlösungsstrategien abnehmen. Dies wiederum ermöglicht es, von Vermeidungsverhalten (Avoidance) Abstand zu nehmen – es ist nun nicht mehr nötig, panisch, phobisch oder depressiv bzw. durch Rückzug und Isolation möglichen Gefahren eines Wiedererlebens traumatischer Ereignisse auszuweichen.
Mitunter mag dies reichen. Es ist auf alle Fälle die Basis einer gelungenen Begleitung und absolut notwendig, um Menschen vor den destruktiven Folgeerscheinungen des posttraumatischen Belastungssyndroms zu schützen.
Psychoedukation und Psychotherapie
Darüber hinaus kann, wenn der Betroffene es wünscht und der fürihn subjektiv richtige Zeitpunkt gekommen ist, entweder durch Psychoedukation oder durch therapeutische Maßnahmen im eigentlichen Sinne versucht werden, die traumatischen Ereignisse ins bewusste Erleben zu reintegrieren. Dies kann aber erst geschehen, wenn genügend emotionale Sicherheit, Vertrauen in die Selbstwirksamkeit des eigenen Tuns sowie die Beziehung zu anderen Menschen (u. a. den Therapeuten) sowie die Erfahrung, in tatsächlicher Sicherheit vor weiteren Traumen zu sein, vorliegt. (Jemand, der permanent damit rechnen muss, wieder verfolgt, gefoltert, vergewaltigt oder körperlich missbraucht zu werden, kann und sollte sich also nicht auf eine Therapie einlassen, bevor diese äußeren Gefährdungen ausgeschlossen sind).
Traumatherapeutische Ansätze
Bei einer weiterführenden, letztlich auf Integration des traumatischen Erlebens ausgerichteten Psychotherapie stehen vor allem die traumafokussierte kognitiv-behaviorale Therapie (Tf-KBT, Landolt 2008), das Eye-Movement-Desensitization-and-Reprocessing (EMDR; Hensel 2007), die Narrative Expositionstherapie für Kinder (Kidnet, Ruf et al. 2008), die Traumazentrierte Spieltherapie (Weinberg / Hensel 2008) sowie Psychodynamisch-Imaginative-Traumatherapie (PITT; Appel-Ramp 2008) zur Verfügung. Sie alle sind inzwischen recht gut evaluiert, haben einige Spezifika, gleichzeitig aber einige Grundprämissen, die am Beispiel der trauma-fokussierten kognitiv-behavioralen Therapie kurz erläutert werden sollen.
Ansatz einer jeden Therapie ist der Aufbau stabiler Beziehungen, der absolute Schutz vor Retraumatisierungen (auch durch fehlgeschlagene oder inadäquate Therapien!) und die emotionale, soziale und körperliche Stabilisierung. Erst dann kann im Rahmen von Psychoedukation auf einige generelle Aspekte eines traumatischen Geschehens eingegangen werden. Die hierbei auftretenden Affekte sollten erkannt und benannt sowie im Rahmen von Entspannungsverfahren und anderen, in der pädagogischen Arbeit bereits kennen gelernten Skills, effektiv reguliert werden können. Konkret heißt dies, dass bei der Begegnung traumatischer Erinnerungen die damit verbundenen Gefühle immer wieder bearbeitet werden sollten, damit die Konfrontation mit dem Trauma nicht wieder übermächtig wird oder gar zu erneuten Intrusionen führt (dies würde, wie im biologisch orientierten Teil dieses Kapitels gezeigt, zu einer Retraumatisierung und zu einer Festigung der dysfunktionalen neuronal-strukturellen Verbindungen führen). Traumaexposition (die Konfrontation mit traumatischem Erleben oder beispielsweise mit Orten, an denen das Trauma stattgefunden hat, das Ansehen von Fotos etc.), aber auch das Traumanarrativ (also Erzählungen vom traumatischen Erleben) sollten also sehr vorsichtig und unter Berücksichtigung dessen, was der Betroffene verkraften kann, stattfinden. Bei der Screen-Technik werden Betroffene beispielsweise aufgefordert, Teile ihres traumatischen Erlebens wie in einem Film zu erzählen, wobei sie den Film anhalten und damit das szenische Geschehen verlassen können und sollen, wenn sie beispielsweise Gefühle wieder zu übermannen drohen. Neben der Identifikation und Bearbeitung dysfunktionaler Gedanken (beispielsweise des Gedankens, dass von allen Männern sexuelle Gefahr ausgeht) liegt das Ziel der Traumatherapie auch in dem Einüben alternativer Verhaltensweisen und Copingstrategien sowie der langsamen Integration des traumatischen Geschehens in das bewusste Erleben. Aber der entscheidende Punkt ist sicherlich, dass ein solches Prozedere letztlich zur emotionalen Stabilisierung beitragen muss. Tut es das nicht, ist die biographische Konfrontation mit den ursprünglichen Traumen also zu belastend, droht die Gefahr einer weiteren, jetzt iatrogenen (durch den Therapeuten verursachten) Traumatisierung.
Zusammenfassend können wir also festhalten, dass das Wissen um die neurobiologischen Vorgänge im Gehirn im Gefolge eines schweren Traumas bzw. schwerer sich wiederholender Traumata notwendig und hilfreich ist, um Symptome und dysfunktionale Entwicklungen über lange Phasen des Lebens besser zu verstehen und einzuordnen. Darüber hinaus verhilft uns dieses Wissen zu der Erkenntnis, dass es im Wesentlichen um eine Stabilisierung vertrauenswürdiger Beziehungen, eine klare Strukturierung, das Schaffen von Vertrauen in die eigenen Kräfte und insbesondere den bleibenden, nachhaltigen und absolut verlässlichen Schutz vor weiteren (Re-)Traumatisierungen geht. Weiterhin wird verständlich, dass dies die Voraussetzungen für weitergehende, integrative psychotherapeutische Verfahren sind – die bei Monotraumen möglicherweise relativ schnell, bei tiefgreifenden, frühkindlichen und sequenziellen politraumatischen Verletzungen hingegen möglicherweise erst nach langer Zeit psychischer Stabilisierung zur Anwendung kommen sollten.
Auf einen Blick
■ Existenzielle, lebensbedrohliche Stressoren können zu Traumen führen, bei denen die Reaktionen des Individuums über die üblichen Stressreaktionen (flight-and-fight-reaction, freezing) hinausgehen. Traumatische Reaktionen sind als lebenserhaltende und somit normale Reaktionen in unnormalen (nämlich extrem bedrohlichen) Situationen anzusehen.
Читать дальше