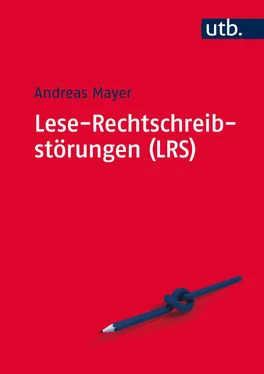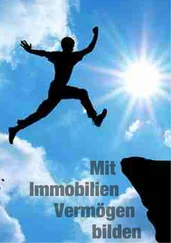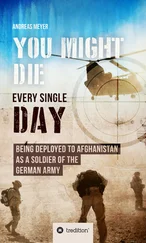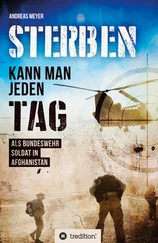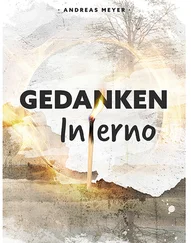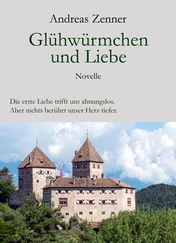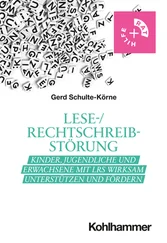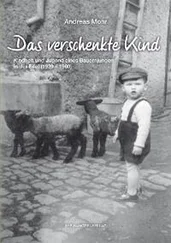Andreas Mayer - Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)
Здесь есть возможность читать онлайн «Andreas Mayer - Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Lese-Rechtschreibstörungen (LRS): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dieses Buch bietet verständliche und ausführliche Information zu Früherkennung, Diagnose, Förderung und Therapie bei einer Lese-Rechtschreibstörung (LRS). Es gibt einen Überblick über Aufbau, Inhalte und Ziele gängiger Förderprogramme.
Neueste Erkenntnisse werden mit konkreten Hinweisen für die schulische und therapeutische Praxis verknüpft.
Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
visuelle Theorie
Neben phonologischen und allgemein auditiven Verarbeitungsdefiziten werden bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung häufig auch Probleme in der visuellen Wahrnehmung beobachtet. So werden Buchstaben beispielsweise als verschwommen wahrgenommen oder miteinander verwechselt (z. B. „q“ und „p“ oder „d“ und „p“; vgl. Terepocki et al. 2002). Von einigen Forschern werden daher Probleme im Lesen und Schreiben auf basale visuelle Defizite zurückgeführt, da das Erkennen von Worten und Buchstaben im Vergleich zu normallesenden Personen deutlich beeinträchtigt sei (Livingstone et al. 1991; Stein / Walsh 1997). Verfechter der visuellen Theorie vermuten eine Fehlfunktion des magnozellulären Pfads des visuellen Systems, das unter anderem für Bewegungs-, Orts- und Geschwindigkeitswahrnehmung verantwortlich ist, woraus Probleme in der binokularen Kontrolle und der visuell-räumlichen Aufmerksamkeit entstehen würden (Hari / Renvall 2001; Stein / Walsh 1997). Empirische Unterstützung findet diese Annahme durch psychophysische Studien, die eine geringere Sensitivität für visuelle Muster niedriger räumlicher und hoher zeitlicher Frequenz (Variation der Helligkeitswerte und Veränderungen der Reizkonstellationen im Zeitverlauf) bei Menschen mit Lese-Rechtschreibstörung aufdecken konnten (Cornelissen et al. 1993; Lovegrove et al. 1980).
Aufmerksamkeitsdefizithypothese
Neben visuellen Wahrnehmungs- bzw. Verarbeitungsschwierigkeiten wird von einigen Forschern auch ein visuelles Aufmerksamkeitsdefizit als zentrale Ursache der Lese-Rechtschreibstörung diskutiert (Facoetti et al. 2003). Bei diesen Überlegungen steht die Beobachtung im Mittelpunkt, dass Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung bei seriellen Suchaufgaben, die Aufmerksamkeit erfordern, beeinträchtigt sind, nicht aber bei automatisch ablaufenden parallelen Suchaufgaben (Marendaz et al. 1996). Studien zur visuellen Aufmerksamkeit konnten zudem zeigen, dass Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung eine asymmetrische Verteilung der Aufmerksamkeit im visuellen Feld aufwiesen, da sie im linken Gesichtsfeld dargebotene Zielreize schlechter erkennen konnten als Reize, die im rechten Gesichtsfeld präsentierte wurden. Dieses Phänomen wurde von den beteiligten Forschern als sogenannter linksseitiger Mini-Neglect bezeichnet (Facoetti et al. 2001). Aufmerksamkeitsdefizite dieser Art könnten die Enkodierung von Buchstabenabfolgen beim Lesen stören, wodurch visuell ähnliche Buchstaben und Wörter verwechselt werden können. Interessanterweise konnte empirisch gezeigt werden, dass phonologische Verarbeitungsdefizite und visuelle Aufmerksamkeitsstörungen bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung statistisch nicht bedeutsam zusammenhängen, beide jedoch unabhängig zur Vorhersage der Leseleistung beitragen (Valdois et al. 2003). Ein Aufmerksamkeitsdefizit scheint also zumindest bei einer Teilgruppe verantwortlich für die Ausbildung einer Lese-Rechtschreibstörung zu sein.
zerebelläre Defizithypothese
Möglicherweise steht eine gestörte Lese-Rechtschreibentwicklung auch im Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung des Kleinhirns (Cerebellum), wodurch unterschiedliche kognitive Defizite entstehen könnten (Nicolson et al. 2001). Das Cerebellum ist verantwortlich für die Steuerung motorischer Prozesse und damit auch an artikulatorischen und somit sprachlichen Fähigkeiten beteiligt. Eine gestörte Artikulation würde den Aufbau korrekter phonologischer Repräsentationen beeinträchtigen und dadurch langfristig Probleme in der Verarbeitung von Schriftsprache verursachen. Darüber hinaus ist das Cerebellum bei der Automatisierung von Prozessen, beziehungsweise Aufgaben mit sich wiederholenden Mustern, beteiligt (z. B. Bewegungen im Sport), was sich ebenfalls auf das Erlernen von Graphem-Phonem-Zuordnungen auswirken könnte. Empirische Befunde über schlechtere Leistungen von Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung bei unterschiedlichen motorischen Aufgaben (Fawcett et al. 1996) und in Schätzaufgaben mit zeitlichen Intervallen (Nicolson et al. 1995) unterstützen diese Annahme.
Die zerebelläre Defizithypothese ist zum Teil massiver Kritik ausgesetzt, und sowohl ihre empirische Basis (Raberger / Wimmer 2003) als auch das postulierte Automatisierungsdefizit wurden wiederholt angezweifelt. Zudem scheinen zerebelläre Beeinträchtigungen nur bei einer Teilgruppe von Personen zu einer Lese-Rechtschreibstörung zu führen.
magnozelluläre Theorie
Die Begründer der magnozellulären Theorie versuchen, die verschiedenen Defizite, die bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung beobachtet wurden, in einem übergreifenden Erklärungsansatz zusammenzuführen (Stein / Walsh 1997). Dabei gehen sie davon aus, dass die Fehlfunktionen im magnozellulären System nicht nur das visuelle System, sondern alle Modalitäten (visuelle, auditive und taktile) betreffen. Funktionsdefizite des Cerebellums sind demnach fehlerhaften Informationen aus verschiedenen magnozellulären Systemen geschuldet (Stein et al. 2001). Die Annahmen werden mit Ergebnissen untermauert, die belegen konnten, dass Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung auch Schwierigkeiten in taktilen Aufgaben zeigen (Grant et al. 1999; Stoodley et al. 2000) und dass bei einer Teilgruppe visuelle und auditive Probleme gleichzeitig beobachtet werden konnten (Cestnick 2001; Van Ingelghem et al. 2001; Witton et al. 1998).
kritische Betrachtung der Theorien
In der internationalen Forschung hat sich die phonologische Theorie als der am besten erforschte und anerkannteste Erklärungsansatz für die Entstehung einer Lese-Rechtschreibstörung etabliert. Mittlerweile wird vermehrt darüber diskutiert, inwieweit bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung tatsächlich ein Defizit in der Repräsentation phonlogischer Informationen vorliegt. Möglicherweise sind die Repräsentationen an sich nicht beeinträchtigt, sondern der Zugriff auf diese Informationen im mentalen Lexikon ist gestört (Ramus / Szenkovits 2008). Daher gilt es zu klären, inwieweit es sich bei einer defizitären phonologischen Verarbeitung um ein Speicherproblem (Informationen werden fehlerhaft eingespeichert) oder ein Abrufproblem (Informationen werden fehlerhaft bzw. unvollständig abgerufen) handelt. Darüber hinaus bleibt im Rahmen der phonologischen Theorie ungeklärt, warum bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung häufig auch sensorische und motorische Defizite beobachtet werden können. Bisher werden nicht sprachliche Faktoren als zusätzliche Marker beschrieben und berücksichtigt, aber nicht als signifikanter Einflussfaktor gewertet (z. B. Snowling 2000). Interessanterweise wird in einigen Studien auch von massiven Lese-Rechtschreibschwierigkeiten berichtet, ohne dass eine Beeinträchtigung der phonologischen Verarbeitung ermittelt werden konnte (Castles / Coltheart 1996; Valdois et al. 2003).
Die zerebelläre Defizithypothese legt ihren Fokus einseitig auf motorische Beeinträchtigungen und hat dadurch keine Erklärungsansätze für potenzielle sensorische Defizite, die bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung beobachtet werden können. Kritisiert wird zudem der direkte kausale Bezug zwischen Artikulation und phonologischer Verarbeitung bzw. der allgemeinen Sprachentwicklung. In vielen Studien wurden darüber hinaus nur geringe oder gar keine motorischen Defizite bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung gefunden. Daher wird vermutet, dass Probleme dieser Art möglicherweise nur bei Personen mit einer komorbid auftretenden Aufmerksamkeitsstörung ermittelt werden können (Denckla et al. 1985; Wimmer et al. 1999).
Durch ihre übergreifende Ausrichtung bietet die magnozelluläre Theorie einen integrativen Erklärungsansatz der Lese-Rechtschreibstörung, der sowohl kognitive, sensorische als auch motorische Defizite berücksichtigt. Insgesamt werden allerdings umfassende Einschränkungen und Schwächen der Theorie diskutiert (Ramus 2001). Befunde weisen beispielsweise darauf hin, dass nur bei einem Teil der Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung auditive und visuelle Probleme feststellbar sind. Darüber hinaus können visuelle Probleme bei verschiedenen visuellen Anforderungen beobachtet werden und scheinen daher nicht spezifisch für rein magnozelluläre Aufgaben zu sein (Skottun 2000). Insgesamt ist die empirische Befundlage für die Bestätigung eines magnozellulären Verarbeitungsdefizits bei Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung als eher schwach anzusehen. Des Weiteren gibt es Kritik an den Methoden, mit denen die Funktion des magnozellulären Systems untersucht wurden, und mehrere Studien konnten keine Unterschiede in magnozellulären Funktionen zwischen normalen und lese-rechtschreibgestörten Lesern finden (Skottun 2000). In einigen Untersuchungen mit Personen, bei denen Defizite in magnozellulären Funktionen ermittelt werden konnten, traten zudem keine Beeinträchtigungen in der Leseleistung auf (Lehmkuhle et al. 1993).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.