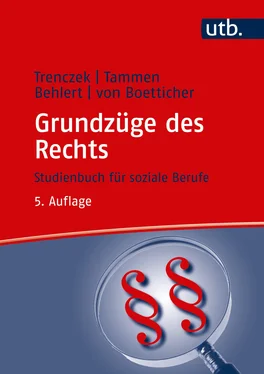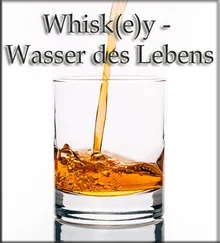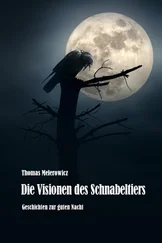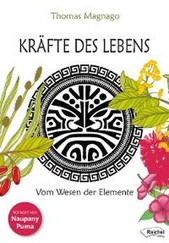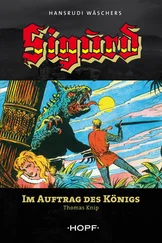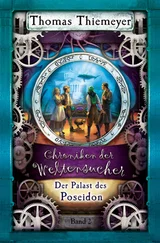Im Hinblick auf den Streitgegenstand und die Beweisführung gilt im streitigen Verfahren der sog. Beibringungsgrundsatz, d. h. das Gericht ist an die Tatsachen, die von den Parteien vorgebracht werden, gebunden (eine Ausnahme gilt z. B. bei falschen Eingeständnissen zugunsten der gegnerischen Partei, vgl. § 138 Abs. 1 ZPO). Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, gelten grds. als zugestanden (§ 138 Abs. 3 ZPO).
Beweislast
Werden Sachverhalte bestritten, müssen sie grds. von der Partei bewiesen werden, die sich auf sie beruft. Eine Prüfung von Tatsachen von Amts wegen erfolgt nur ausnahmsweise, z. B. im Hinblick auf Prozessvoraussetzungen oder die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen.
Zwangsvollstreckung
Insolvenzverfahren
Die Zwangsvollstreckung ist das staatliche Verfahren zur zwangsweisen Durchsetzung von Rechtsansprüchen. Die eigenmächtige Durchsetzung (Selbstjustiz) auch von berechtigten Forderungen ist grds. rechtswidrig und nur ausnahmsweise in den Grenzen der erlaubten Selbsthilfe (z. B. zu Gefahrenabwehr, §§ 229, 562b, 859 BGB) zulässig. Unterschieden werden die Zwangsvollstreckung wegen privatrechtlicher Einzelforderungen, die Zwangsmaßnahmen nach dem FamFG (z. B. die Auferlegung von Zwangsmitteln nach § 35 FamFG), die strafrechtliche Strafvollstreckung (hierzu IV-3.2) sowie die Verwaltungsvollstreckung (hierzu III-1.5). Von der (zivilrechtlichen) Zwangsvollstreckung zu unterscheiden ist das sog. Insolvenzverfahren, bei dem es nicht um eine Einzelforderung gegen den Schuldner geht, sondern der Schuldner zahlungsunfähig ist und die gegen ihn gerichteten Forderungen insgesamt nicht bedienen kann (zum sog. Privat- bzw. Verbraucherinsolvenzverfahren vgl. II-1.3.1.2).
Die privatrechtliche Zwangsvollstreckung ist nicht schon zulässig, wenn jemand seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt. Vielmehr muss der Gläubiger bei Leistungsstörungen grds. vor Gericht klagen und einen Vollstreckungstitel erwirken, den er insb. mit einem rechtskräftigen Urteil erlangt (§§ 704, 794 ZPO). Im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung ist ein Gerichtsverfahren nicht notwendig, vielmehr genügen ein bestandskräftiger VA (hierzu II-1.4.1.2) und eine Vollstreckungsanordnung. Behörden können sich somit durch einen Bescheid ihre Vollstreckungstitel selbst schaffen, wenn sich der Bürger nicht rechtzeitig dagegen wehrt (insb. durch Widerspruch).
Pfändung
Aufgrund des staatlichen Gewaltmonopols dürfen grds. nur staatliche Gerichte (Vollstreckungsgericht) sowie die Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstreckung insb. durch Pfändung (entweder Forderungsüberweisung oder Beschlagnahme von beweglichen Sachen, sichtbar durch den „Kuckuck“ als Pfandsiegel) durchführen.
Zur Gewährleistung eines Existenzminimums hat der Gesetzgeber sog. Pfändungsfreigrenzen bestimmt, die sich nach dem Nettoeinkommen und der Zahl der unterhaltspflichtigen Personen richten (§§ 850 ff. ZPO). Sie betragen derzeit für eine Einzelperson 1049,99 €, bei einer unterhaltspflichtigen Person 1439,99 € sowie zusätzlich 220 € für jede weitere unterhaltspflichtige Person (wenn der Schuldner den Unterhalt auch tatsächlich zahlt). Vom Einkommen, welches über die Pfändungsfreigrenzen hinausgeht, verbleibt ein Teil ebenfalls beim Schuldner. Allerdings sind bestimmte Einkommensbestandteile (z. B. Aufwandsentschädigungen, Gefahrenzulagen, Erziehungsgelder und Studienbeihilfen) sowie unterschiedliche Formen von Renten- und Unterstützungsleistungen der Pfändung nicht oder nur bedingt unterworfen (§§ 850a, 850b ZPO). Im Fall der Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen gelten die in § 850c ZPO bezeichneten Pfändungsgrenzen nicht (§ 850d ZPO). Besonderheiten gelten für die Pfändung von Girokonten: Seit dem 01.07.2010 können Kontoinhaber ihr Girokonto in ein Pfändungsschutzkonto (sog. P-Konto) umwandeln lassen, bei dem der Schuldner ohne gerichtliches Verfahren einen automatischen Basis-Pfändungsschutz in Höhe des unpfändbaren Freibetrags erhält (§ 850k ZPO). Die Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen führt gleichzeitig zur Erhöhung des Sockelpfändungsschutzes beim P-Konto.
5.3.2 Freiwillige Gerichtsbarkeit
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Mit freiwilliger Gerichtsbarkeit bezeichnet man eine Reihe ganz unterschiedlicher Angelegenheiten, die von den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit, z. T. auch von Notaren und Behörden, nach dem zum 01.09.2009 in Kraft getretenen „Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ (FamFG) wahrgenommen werden und sich gerade dadurch – unabhängig von ihrem höchst unterschiedlichen Themenkreis – von den streitigen Verfahren nach der ZPO abgrenzen (ausführlich Jurgeleit 2010; Meysen 2014). Neben den Familiensachen (§§ 111 ff. FamFG), für die das FamFG eine bereichsspezifische Verfahrensordnung darstellt (hierzu ausführlich II-2.1 u. II-2.4.6), gehören nach § 23a GVG zu den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit insb.
■ Betreuungssachen (§§ 271 ff. FamFG),
■ Unterbringungssachen (§§ 312 ff. FamFG),
■ betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen (§§ 340 f. FamFG),
■ Nachlass- und Teilungssachen (§§ 342 ff. FamFG),
■ Registersachen und unternehmensrechtliche Verfahren (§§ 374 ff. FamFG),
■ Verfahren in Freiheitsentziehungssachen (§§ 415 ff. FamFG),
■ Aufgebotsverfahren (§§ 433 ff. FamFG),
■ Grundbuchsachen (§ 23a Abs. 2 Nr. 8 GVG),
■ sonstige Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit sie durch Bundesgesetz den Gerichten zugewiesen sind (§ 23a Abs. 2 Nr. 11 GVG; §§ 410 ff. FamFG).
Zum Teil (z. B. Beurkundungen, Grundbuchsachen) handelt es sich um Rechtspflegeakte, die auch als verwaltungsähnliche Tätigkeit qualifiziert und deshalb Rechtspflegern übertragen werden. Einige sog. Unterhalts- und Güterrechtskonflikte gelten als sog. Familienstreitsachen (§§ 112 f. FamFG), weshalb insoweit auch einige Regelungen der ZPO entsprechende Anwendung finden.
Untersuchungsgrundsatz
In den Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit spricht man nicht von Klage (und damit auch nicht von Kläger und Beklagtem), vielmehr wird das Gericht von Amts wegen oder auf Antrag tätig. Man spricht deshalb vom Antragsteller und den Beteiligten. Das Verfahren endet i. d. R. nicht mit einem Urteil, sondern durch Beschluss (§§ 38 ff., 95 Abs. 2 FamFG), wogegen das Rechtsmittel der Beschwerde (nicht Berufung) eingelegt werden kann (§§ 58 ff. FamFG). In vielen Angelegenheiten besteht kein Anwaltszwang (Ausnahme teilweise in Familiensachen, § 113 FamFG). Anders als in den streitigen Zivilprozessen gilt in der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Untersuchungs- bzw. Amtsermittlungsgrundsatz, d. h. das Gericht entscheidet selbst, welche Ermittlungen es anstellt und welche Beweismittel es heranzieht. Die Verhandlungen sind meist nicht öffentlich (§ 170 Abs. 1 GVG) oder werden oft ohne mündliche Verhandlung nach Aktenlage entschieden.
5.3.3 Kostenrisiken
Anders als bei den sozialgerichtlichen oder manchen verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren besteht im Zivilverfahren ein z. T. erhebliches Kostenrisiko für den Bürger. Zunächst muss der Kläger einen Gerichtskostenvorschuss zahlen, d. h. das Gericht wird überhaupt erst dann tätig, wenn ein Teil der zu erwartenden Gerichtskosten vorab bezahlt worden ist (Ausnahme für öffentliche Träger der Jugend- und Sozialhilfe; § 2 GKG; § 64 Abs. 3 S. 2 SGB X; teilweise nach Landesrecht auch für freie Träger). In der streitigen Gerichtsbarkeit besteht ab der Landgerichtsebene Anwaltszwang (§ 78 Abs. 1 ZPO), in Familiensachen z. T. bereits beim Amtsgericht (§ 114 FamFG). Derjenige, der das Gerichtsverfahren verliert, muss der anderen Partei die Prozess- einschließlich der Anwaltskosten erstatten (§ 91 Abs. 1 ZPO). Im FamFG-Verfahren erfolgt die Kostenverteilung nach „billigem Ermessen“ (§ 81 Abs. 1 FamFG), d. h. es wird eine möglichst faire Verteilung vorgenommen. Für viele Bürger ist deswegen der Zugang zum Recht durchaus nicht leicht. Der durch das GG garantierte Rechtsschutz verlangt aber, dass die Prozessführung und -verteidigung grds. nicht an fehlenden finanziellen Mitteln einer Partei scheitert darf, weshalb mit der Prozesskostenhilfe (PKH) (§§ 114 ff. ZPO) bzw. der Verfahrenskostenhilfe (§§ 76 ff. FamFG) eine Form rechtsbezogener Sozialhilfe zur Verfügung steht. PKH wird auch in arbeitsrechtlichen Verfahren (§ 11a ArbGG) gewährt.
Читать дальше