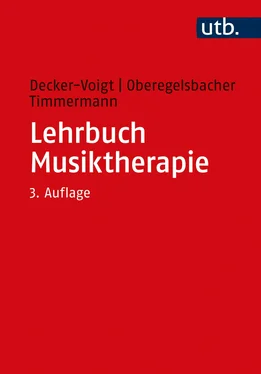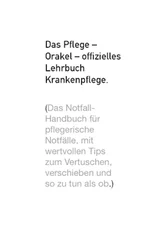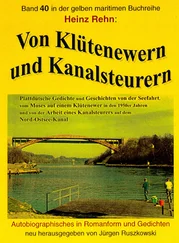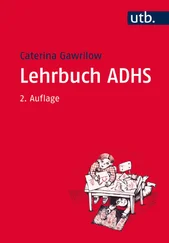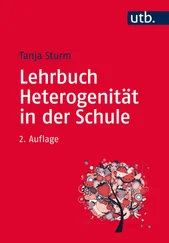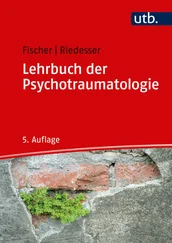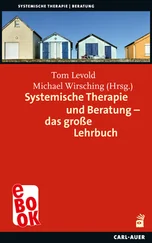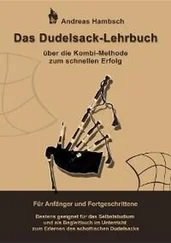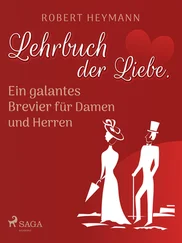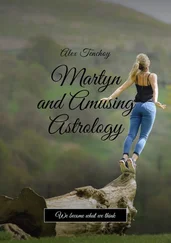In verbalen Formen von Psychotherapie steht bei der Bearbeitung der auftauchenden Problematik das Wort, die Sprache im Vordergrund, während gleichzeitig im Hintergrund andere Kräfte intensiv mitwirken. Diese haben einerseits zu tun mit dem Atmosphärischen, mit Stimmung, Schwingung, Resonanz, Rhythmen usw. sowie mit den Botschaften jenseits des semantischen Gehaltes von gesprochenen Worten, den sog. paralinguistischen oder außersprachlichen Elementen des Sprechens: Stimmklang, Tonhöhe, Lautstärke, Sprachrhythmen sowie Gestik, Mimik, Körperhaltungen, -bewegungen, -reaktionen (s. Nitschke 1984; Timmermann 2004a). Auch die präverbale Bedeutung des Rhythmus von Sprechen und Schweigen im therapeutischen Gespräch wurde bereits untersucht (Kächele et al. 1973). Dazu kommen eine Fülle von Faktoren, die in der gesamten Haltung des Therapeuten wurzeln und im Bündnis mit dem Klienten eine heilsame Beziehung begründen können.
Diese Beispiele sollen verdeutlichen, wie psychotherapeutische Techniken in einer die Grundorientierungen, Verfahren und Methoden überschreitenden bzw. übergreifenden Weise und bezogen auf das spezifische Medium Musik in der therapeutischen Situation zur Wirkung gebracht werden können.
Die Praxeologie zeigt, dass musiktherapeutisches Handeln gleichermaßen von Wissen und Intuition getragen ist und auf beiden Ebenen vom Musiktherapeuten umfassende Fähigkeiten verlangt.
Wissen und
Intuition

Timmermann, T. (1998): Rezeptive und aktive Musiktherapie in der Praxis. In: Kraus, W. (Hrsg.): Die Heilkraft der Musik. C. H. Beck, München, 50–66
Timmermann, T. (2004): Tiefenpsychologisch orientierte Musiktherapie. Bausteine für eine Lehre. Reichert, Wiesbaden
7Improvisation
von Tonius Timmermann
„Die Improvisation schöpft aus dieser Stille, dieser Ruhe,
in der das Unaussprechliche dargeboten wird,
um es im nächsten Augenblick wieder in die Stille zu entlassen.“
(Christopher Dell)
Die ursprüngliche, spontane und „naive“ Begegnung mit der Musik hat immer experimentellen Charakter. Sie ist ein Wechselspiel aus Tonerzeugung und Lauschen auf das, was dabei erklingt. Musizieren ist ursprünglich immer improvisiert. Der Mensch experimentiert mit seiner Stimme oder Materialien, die Töne hervorbringen. Er entwickelt Instrumente, zunächst eintönige, dann mehrtönige, die er, seinem harmonikalen Instinkt folgend, auf ganzzahlige Intervalle zurechtstimmt. Er entdeckt Tonfolgen, die ihn berühren, die ihm etwas sagen, Melodien, die er schließlich wiederholt, die sich durch diese Wiederholbarkeit als Lieder, als Musikstücke manifestieren und Musikkultur bilden.
In den meisten Musikkulturen der Erde hat sich dabei das Element des Improvisatorischen auch innerhalb mehr oder weniger komplexer Formbildung erhalten, nur in der klassischen europäischen Musikentwicklung hat es sich eher zurückentwickelt. Allerdings kam es im Laufe des 20. Jh. auch zu kulturübergreifenden musikalischen Entwicklungen und neuen Freiheiten. In der Musik der schwarzen Amerikaner und der davon stark beeinflussten Rock- und Popmusik seit den 60er und 70er Jahren sowie in Teilen der Avantgarde, der Neuen Musik wurde das Improvisatorische wieder ein wesentliches Element in der modernen Musikentwicklung.
Musikkultur
Wesentliche Impulse für die Wiederentdeckung des Improvisatorischen kamen auch aus den Reformbewegungen (Fitzthum 2003) und der sich in diesem Zusammenhang entwickelnden Rhythmik und künstlerischen Reformpädagogik. Heinrich Jacoby (1980; 1984), ein Musikpädagoge, der mit Alfred Adler, einem Psychotherapeuten der ersten Stunde, befreundet war, bietet einen guten Ansatz für die Verwendung von improvisierter Musik in der Musiktherapie, indem er die Künste mit der Muttersprache vergleicht: Grundsätzlich kann sich jeder darin äußern, nicht nur Dichter und Schriftsteller. Improvisation ist musikalische „Sprache“ bevor Musik immer mit Kunst oder Unterhaltung verknüpft ist. Improvisation kann Kunst oder Unterhaltung sein, zunächst aber ist sie Experiment. Sie findet ihre Form gemäß dem jeweiligen musikalischen Inhalt.
Reformbewegung
In der Musiktherapie kennen wir freie und strukturierte Improvisationen. Strukturen können sein: musikalische Vorgaben (z. B. „schwarze Pentatonik“ am Klavier) oder Vorgaben wie Themen, Spielregeln, Rollenspiele. Inhalte freier Improvisationen entstehen aus dem Hier und Jetzt der improvisierenden Person mit ihrer ganzen bio-psycho-sozialen Geschichte. Sie sind von außen nur durch das Potenzial an innerer Freiheit und seelischer Kraft des Therapeuten begrenzt, also beispielweise durch seine eigenen Ängste bezüglich der Wirklichkeiten, die ans Licht treten können, oder eben seiner Fähigkeit, dem standzuhalten und Halt, Sicherheit und Schutz anzubieten. Anders ausgedrückt: Das Innere des Klienten kann in dem Maße in einer Improvisation zum Ausdruck kommen und kommuniziert werden, wie er sich im therapeutischen Setting (Beziehung!) sicher, gehalten und geschützt fühlt. Ob eine freie oder eine in welcher Weise und in welchem Maß auch immer strukturierte Improvisation angeboten wird, entscheidet der Therapeut aufgrund der Indikation und dem jeweiligen Prozessmoment.
freie und
strukturierte
Improvisation
Ist eine Person in einer bio-psycho-sozialen Krise, drückt sich diese – auf die jeweils mögliche Weise – in Inhalten und Formen der improvisierten Musik aus. Für die geschulte Musiktherapeutin bieten diese musikalischen Äußerungen Anlass zu Reaktion und Mitgestaltung der Interaktion im Partner- und Gruppenspiel der aktiven Musiktherapie. Wenn möglich, wird dieser Prozess auch immer wieder verbal bearbeitet, wenn nicht, erfolgt die Bearbeitung im Musikalischen, begleitet von Gestik, Mimik und anderer Körperkommunikation.
Hörbarkeit
der Krise
Im Rahmen aktiver Vorgehensweisen, aber auch, wenn er in rezeptiven Vorgehensweisen für den Klienten improvisiert, gestaltet der Therapeut die Musik aufgrund seiner professionellen Entwicklung. Dabei schwingt auch im spielenden Musiktherapeuten dessen bio-psycho-soziale Geschichte mit, die er jedoch im Rahmen einer Lehrmusiktherapie studiert hat, an der er arbeitet und die er deswegen nicht mit der des Klienten vermischt. Im Zweifelsfall nimmt er Supervision. Die behandlungsbezogene therapeutische Gestaltung der improvisierten Musik erfolgt gemäß dem Sinn der jeweiligen Intervention bzw. Technik, die hier angewendet werden soll. Die konkrete Musik ist – bei allem Wissen und Können – weitgehend intuitiv gestaltet, basiert auf Flexibilität und Elastizität, erfasst eher eine Stimmung, als dass sie sich direkt an vorgegebenen Formen orientiert. (Unter Forschungsgesichtspunkten ist es allerdings sehr interessant, welche Formen intuitiv gestaltet werden.)
Persönlichkeit
des Therapeuten
Improvisation ist in der Musiktherapie das am häufigsten angebotene Mittel zur gemeinsamen Gestaltung des zentralen psychotherapeutischen Wirkfaktors, nämlich der Beziehung. Die therapeutischen Möglichkeiten improvisierter Musik liegen in der Mitgestaltung der Begegnung zwischen Musiktherapeutin und Klient durch aktive und rezeptive Vorgehensweisen.
Gestaltung
von Beziehung
Grenzen sind gegeben, wo der Klient aufgrund bio-psycho-sozialer Gegebenheiten (wie z. B. schwerem körperlichen Leiden oder dramatischer Angstzustände) nicht in der Lage ist, sich mit Instrumenten oder Stimme auszudrücken und in Beziehung zu gehen, und wo er auch durch das Anhören einer vom Therapeuten improvisierten Musik überfordert ist. Grenzen finden ansonsten alle Vorgehensweisen im adäquaten Maß und der Stille vorher und nachher.
Grenzen
Das lateinische Wort „improvisus“ bedeutet „unvorhersehbar, unerwartet“. Dieser Wortsinn weist auf Möglichkeiten wie Überraschung und plötzlichen Richtungswechsel. Dies wird in der aktiven Musiktherapie gerade dann genutzt, wenn die improvisierte musikalische Begegnung als psychosoziales Übungsfeld genutzt wird. Der Prozess eines improvisierten musikalischen Ablaufs und Beziehungsgeschehens macht Veränderung und Wandlung akustisch deutlich wahrnehmbar und ist ein Spezifikum der Musiktherapie.
Читать дальше