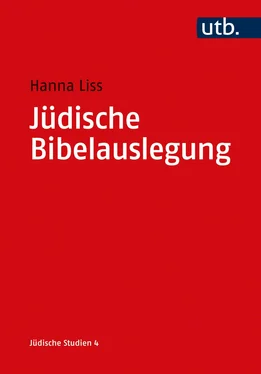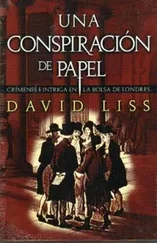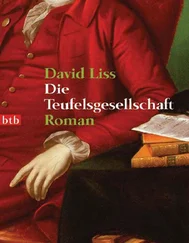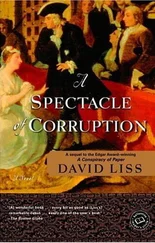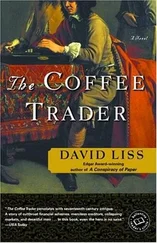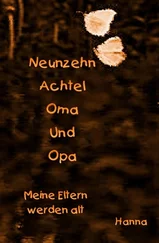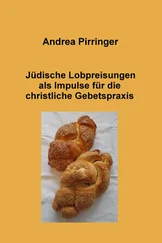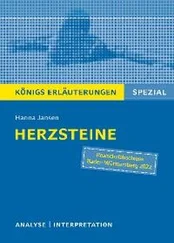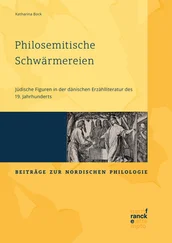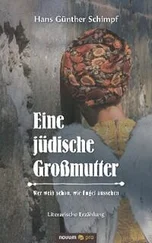1 ...6 7 8 10 11 12 ...40 Philos Bibel war die griechische Septuaginta, obwohl er natürlich wusste, dass diese (ursprünglich) auf Hebräisch vorlag. Seine Auslegungen sind sehr auf den Pentateuch konzentriert (vgl. aber Bloch 2016). Obwohl er nur selten pagane Autoren namentlich zitiert, scheut er sich nicht, Platon als den Heiligsten auszuzeichnen ( katà tòn hierótaton Plátona ; Siegert 1996, 165), und man sieht deutlich, dass es ihm auch daran lag, die jüdischen Texte den heidnischen Autoren als ebenbürtig an die Seite zu stellen. Philo verfasste Quaestiones zu den Büchern Genesis und Exodus, einen allegorischen Kommentar zum Buch Genesis sowie eine Reihe Abhandlungen zum mosaischen Gesetz. Zu den bekanntesten gehören z.B. De Vita Mosis , De Decalogo , De Specialibus Legibus (Siegert 1996, 166–168). Für Philo galt der biblische Mose als ‚Theologe‘ ( theólogos ), weil er die Menschen über die göttliche Natur belehrte (Sheridan 2015, bes. 61–77). Von einigen seiner Schriften ist das griechische Original verloren gegangen.
Der jüdische Historiker Flavius JosephusFlavius Josephus (ca. 37/38–nach 100 u.Z., geboren als Joseph ben Matitjahu ha-Kohen ) gilt als einer der wichtigsten Repräsentanten des hellenistischen Judentums, und sein Weg von Jerusalem nach Rom spiegelt sich auch in seinen Schriften wider (zum Ganzen Schalit 2007; Mason/Kraft 1996).
Bellum Judaicum ‚Der jüdische Krieg‘Sein bekanntestes und erstes (ursprünglich zunächst auf Aramäisch verfasstes und später dann im Griechischen überarbeitetes) Werk ist die in Rom verfasste Geschichte des Jüdischen Krieges ( Bellum Judaicum ), in der er die Seleukidenzeit unter Antiochus IV. Epiphanes sowie den daraus hervorgegangenen Aufstand der Makkabäer* schildert.
Antiquitates Judaicae ‚Jüdische Altertümer‘Josephus’ umfassendstes Werk sind die Jüdische[n] Altertümer ( Antiquitates Judaicae ), die in Ant. 1–11 die Geschichte des jüdischen Volkes von der Schöpfung bis in die nachexilische Zeit schildern und hierbei die Verarbeitung eines großen biblischen Textumfanges (von Gen 1–Esra/Nehemia/Haggai; Mason/Kraft 1996) erkennen lassen. Dieses Geschichtswerk ist keine Bibelauslegung |22|im strengen Sinne; es zeigt vielmehr, dass es Flavius Josephus vor allem darum zu tun war, den nicht-jüdischen Völkern das Judentum als gleichwertige Kultur des Altertums zu präsentieren (Bloch 2011, bes. 23–30). So wählte er den Titel Antiquitates Judaicae in deutlicher Anlehnung an die Antiquitates Romanae des Dionysios von Halikarnassos (ca. 54 v.u.Z.–nach 7 v.u.Z.; Schalit 2007). Die biblischen Erzählungen werden dabei paraphrasiert, und Josephus passt einzelne Geschichten immer wieder an den hellenistischen Literaturgeschmack an (Bloch 2011, bes. 105–120). Dabei integriert er auch Midraschmaterial*, von dem so manche Überlieferung in den Antiquitates ihre einzige bis heute bekannte Quelle hat (Schalit 2007). Obwohl er sicherlich Hebräisch konnte, zeigen seine Schriften eine deutliche Präferenz für die Septuaginta. Josephus hat offenbar sogar Zugang zu samaritanischen* Überlieferungen gehabt (Schalit 2007).
Weitere kleinere (Spät-)Schriften von Josephus sind seine Autobiographie ( Vita ‚Biographie‘) und die apologetische Schrift Contra Apionem ‚Gegen Apion‘ (auch: ‚Über die Ursprünglichkeit des Judentums‘; zum Ganzen Siegert 2011; 2008; Schalit 2007).
c. Von der Kompilationsliteratur zum Autor
Mischna, Talmud und MidraschIst zwar die Hebräische Bibel die textliche Grundlage für das nachbiblische Israel/Judentum und das Christentum, so sind die literarischen Gründungsurkunden des Judentums seit der rabbinischen Zeit die Mischna* und der Talmud* und – für das antike Palästina – der Midrasch* (zum Ganzen Langer 2016, bes. 19–37, 165–180; Stemberger 2011; 2009). Alle diese literarischen Werke sind über einen längeren Zeitraum entstanden und stellen die klassischen Vertreter von Traditions- oder Kompilationsliteraturen dar. Das wichtigste formale Charakteristikum der sog. Traditionsliteratur ist ihr literarischer Aufbau als Kompilation (Goldberg 1987; 1982). Eine Kompilation besteht aus vielen einzelnen Textversatzstücken und -abschnitten, die im Gesamtaufbau einer Schrift nicht unbedingt auf einen literarischen Kontext beschränkt sein müssen. Daher können die verwendeten Einzelteile durchaus an mehreren Stellen wieder eingefügt und wiederholt werden. In der Regel waren dabei stets ein oder mehrere Redaktoren oder Kompilatoren am Werke. Zumeist entstammen die Inhalte – Gesetzessammlungen, aggadische Überlieferungen, rabbinische Dicta, halachische Diskussionen und Entscheidungen – selbst wiederum einer schriftlichen Quelle. Der Redaktor oder Kompilator formuliert also nicht eigens eine sachliche Position und deren literarische Ausführung, sondern stellt vorgegebenes Material neu zusammen und bringt damit einzelne Überlieferungen in einen neuen redaktionellen Zusammenhang.
|23|Redaktion und KompilationDer Redaktor oder Kompilator tritt als schreibendes Subjekt dabei nicht selbst in Erscheinung. (Schreibendes) Subjekt und (thematisches) Objekt rücken zusammen. Daraus folgt nun, dass ein kompilierter Text nicht mit dem Anspruch einer bewussten Abgrenzung gegenüber seinen Quellen auftritt. Kompilation ist Kollektion, d.h. die Erstellung textlicher Einheiten durch Addition und Integration. Im Falle des Midrasch besteht das Ziel in der exegetischen „Aneignung des Bibeltextes im Sinne einer (meist, aber nicht immer) für verschiedene Meinungen offenen Interpretation“ (Langer 2016, 33). Natürlich ist damit keine wahllose und rein quantitative Anhäufung von Textbausteinen gemeint; unterschiedliche Auswahlprozesse lassen sich rekonstruieren. Dennoch bleibt es formal bei einer Zusammenstellung und damit der Addition von Zitaten oder Überlieferungen. Für das biblische wie für das rabbinische Schrifttum bis ins Mittelalter hinein kann sich das Anwachsen kleiner und größerer Mikroformen zu einer Makroform entweder genetisch-linear von kleineren zu größeren Texteinheiten vollziehen oder mehrdimensional, d.h. als gleichzeitige Ausprägung unterschiedlicher literarischer Makroformen ohne gemeinsamen Urtext, entwickeln (vgl. auch bereits die biblischen Parallel-Versionen unter den Textfunden in Qumran). Mit Blick auf die Unterscheidung von Kompilations- und späterer Autorenliteratur gilt es also festzuhalten, dass eine Kompilation ihren Ausgangspunkt weniger bei einzelnen systematischen Themen- oder Fragestellungen nimmt. Vielmehr hat die Kompilation ein schriftliches Corpus zur Grundlage, in das auch formale und inhaltliche Unterschiede, im größeren Kontext auch sachliche oder inhaltliche Widersprüche problemlos integriert werden können. Eine Kompilation ist dadurch charakterisiert, dass ein Kompilator mittels der Zusammenstellung von Überlieferungen oder durch eigene Ausführungen etwas Neues formuliert, dieses Neue jedoch so in das bereits Vorhandene integriert, dass sich die Konturen von Altem und Neuem verwischen (Liss 1994).
Anfänge arabisch-hebräischer AutorenliteraturEin ganz anderes Bild ergibt sich hinsichtlich der Entwicklung von Autorenliteratur, die für die Entstehung der jüdischen Bibelkommentare eine wichtige Rolle spielt. In das aramäisch-hebräischsprachige Judentum findet die Autorenliteratur erst durch die Auseinandersetzung mit dem islamischen Schrifttum (8./9. Jahrhundert) Eingang, sieht man einmal von Ben Sira (vgl. oben Kap. 1.1.a.), Philo von Alexandrien (ca. 20 v.u.Z.–49 u.Z.) und Flavius Josephus (37/38–nach 100 u.Z.) ab, die aber alle der griechisch-römischen Kulturwelt zuzurechnen sind. Die frühesten Exponenten der jüdischen Autorenliteratur finden wir daher auch nicht zufällig entweder auf dem Gebiet der Philosophie (R. Sa‘adja Gaon, 882–942 u.Z.; R. Schelomo ibn Gabirol, 1020–ca. 1058; R. Jehuda ha-Levi, |24|1075–1141 u.a.) oder der Schriftexegese und Grammatik: Neben R. Sa‘adja Gaon sind es hier vor allem die karäischen* Gelehrten sowie die zunächst aramäisch-, dann arabischsprachigen Masoreten des 9. und 10. Jahrhunderts, die andalusischen Grammatiker des 10. Jahrhunderts wie Menachem ibn Saruq und Dunasch ibn Labrat (925–Ende 10. Jahrhundert; Rabin/Sáenz-Badillos 2007), und seit dem 11. Jahrhundert im christlichen Europa R. Schelomo Jitzchaqi (Raschi; ca. 1040–1105), R. Avraham ibn Ezra, R. David Qimchi (Radaq) u.a. Auf dem Gebiet der Halakha* beginnt die Entwicklung zu einer individuellen Auseinandersetzung mit dem halachischen Traditionsstoff mit der Kodifikationstätigkeit von R. Jizchaq ben Ja‘aqov Alfasi (1013–1103; Assaf/Ta-Shma 2007). In der gaonäischen* Zeit gehören dazu insbesondere auch die sog. Responsen, d.h. schriftlich abgefasste religionsgesetzliche Entscheidungen anerkannter rabbinischer Autoritäten. Einschränkend sei jedoch erwähnt, dass sich in den Kommentierungen des Bibel- wie des Talmudkommentars von Raschi durch die sog. Tosafisten* ( ba‘ale ha-tosafot ) eine kollektive Form der Überlieferung behauptet hat, bei der sich jedoch auch Zuschreibungen an die einzelnen Tosafisten finden (vgl. dazu auch Hollender 2008, bes. 10–22). Daneben wurden die tosafot der Tosafisten auch in gesonderten, unter ihrem Namen erscheinenden Sammlungen zusammengestellt. Auf christlicher Seite markiert diese Zeit den Beginn der scholastischen Epoche, in der die bis dahin üblichen Sentenzensammlungen, in denen auch zum größten Teil exzerpiert und kompiliert wurde, durch die quaestio (ab 13. Jahrhundert Quaestionen-Sammlungen) bzw. die theologische summa einzelner Magister abgelöst wurde.
Читать дальше