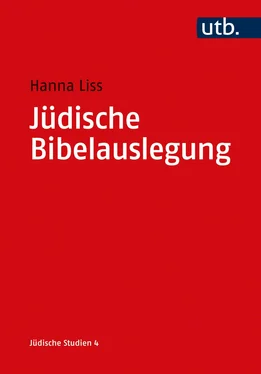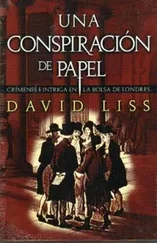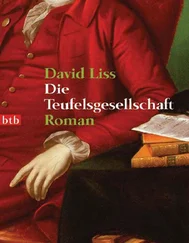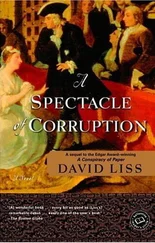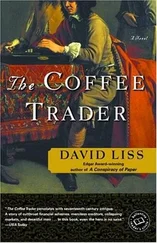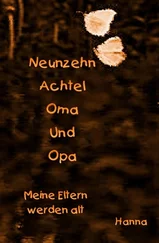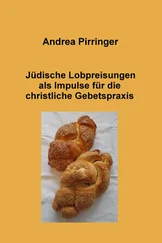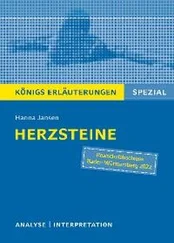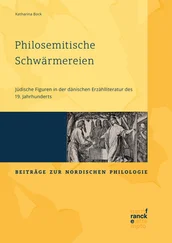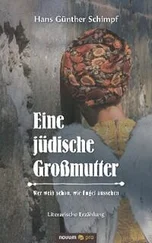Konsolidierung des hebräischen BibeltextesDie Konsolidierungsprozesse des biblischen Textes bilden ab, wie ernst die rabbinische* Elite die Hebräische Bibel als Text nahm, d.h. zunächst einmal als Zeichenmenge erfasste. Am Anfang standen Zahlen: Nach dem Babylonischen Talmud* (bQid 30a) enthält die Tora (Tora-Rolle) 5888 Verse und 304805 Buchstaben. Die ersten Masora-Gelehrten aus Tiberias zählten 5845 Verse, 79856 Wörter und 466945 Buchstaben. Dieser Unterschied lässt sich dadurch erklären, dass es zu rabbinischer Zeit in Babylonien und Eretz Israel verschiedene Traditionen zum Beginn und Ende kleinerer Sinneinheiten gegeben hat (Liss 2019a, 9; Würthwein 1973). Die Anzahl der Wörter und Buchstaben, der Zahlwert eines Wortes oder Buchstabens kann dabei ebenso ernsthaft in die Auslegung eingehen wie ein inhaltliches Motiv. Komplementär dazu kultivierten die rabbinischen Schriftausleger ein sehr formales Schriftverständnis, das Arnold Goldberg als die rabbinische Unterscheidung zwischen Schrift als Mitteilung und dem in der Schrift Mitgeteilten vorgestellt hat: Die Gültigkeit und damit je neue Aktualisierung der Schrift kann nur durch das erstgenannte Verständnis ( Schrift als Mitteilung ) erreicht werden. Das in der Schrift Mitgeteilte gehört der Vergangenheit an und kann von daher nie eine absolute Gültigkeit beanspruchen (Goldberg 1987).
Bibelübersetzungen und TargumimDas Hebräische war für die Rabbinen leschon ha-qodesch „heilige Sprache“. Sie ist die Sprache der göttlichen Offenbarung. Nach der rabbinischen Tradition wurden auch ha-ketav we-ha-mikhtav , d.h. die Form der Buchstaben und die in die Tafeln eingegrabene Schrift (Gottes) schon vor der Welt am Abend des Schabbat, des sechsten Tages, erschaffen (zum Ganzen Liss 2019c). Auch die Buchstabenform war mithin integraler Bestandteil der Offenbarung.
Jüdisch-griechische Übersetzungen der BibelVor dem Hintergrund dieses Verständnisses von ‚Heiliger Schrift‘ muss auch das jüdische Übersetzungsverständnis erklärt werden. Das rabbinische Verständnis (als Hermeneutik der Tannaiten* seit dem 1. Jahrhundert u.Z. und später der rabbinischen Amoräer*) |10|in Babylonien und Eretz Israel unterscheidet sich dabei grundlegend vom jüdisch-hellenistischen. Bei den jüdisch-hellenistischen Autoren wird das Thema Übersetzung mit Blick auf die adäquate Wiedergabe diskutiert, denn es stand außer Frage, dass eine Übersetzung als gleichwertiger Ersatz des Urtextes galt (Veltri 1994, 20).
Die SeptuagintaDie Septuaginta sowie einige Texte von Qumran betonen den Inhalt der Offenbarung. Dieser, und nicht primär die äußere Form, sei auch in der Übersetzung zu bewahren. Die Vorstellung der Unübersetzbarkeit gibt es hier nicht (Veltri 1994, 145). Nach Philo von Alexandrien transportierten die Übersetzer der Septuaginta „Name und Sache“ des Hebräischen, was sie zu hierophántai mache, also solchen, die heilige Geheimnisse enthüllen (Veltri 2002b, 42). Die Septuaginta galt als schriftliche Bibel, die auch im Gottesdienst verwendet wurde (Veltri 2002b, 55). Eine wortwörtliche Übersetzung ( verbum e verbo ) galt dabei als unpassend, weil die Bibel literarische Texte umfasst. Für die bessere Literatur sollte primär am Sinn orientiert übersetzt werden ( sensus de sensu ).
Die Übersetzung des AquilaDass das rabbinische Judentum sich dennoch im Laufe der Zeit von der Septuaginta abgewandt und sogar eine eigene griechische Übersetzung mit der Übersetzung Aquilas angenommen hat (jMeg 1,11; vgl. zum Ganzen Veltri 2002b, 78), liegt an der Funktion dieser Übersetzung und ihrem Verhältnis zum hebräischen Text: Während die Septuaginta die Hebräische Bibel er setzte, setzte die Übersetzung des Aquila (1./2. Jahrhundert; fragmentarisch überliefert in der Hexapla des Origenes, vgl. Field 1875, und in Fragmenten, vgl. de Lange 2015) sie nicht nur zwingend voraus, sondern definierte sich selbst als dem hebräischen Bibeltext subordiniert und diesem zuarbeitend. Diese Übersetzung ist eine Übersetzung verbum e verbo und soll damit eine Erklärung des hebräischen Textes mehr als eine Übertragung ihres Inhaltes ins Griechische sein, was sich auch daran zeigt, dass das Griechische dem Hebräischen durchgehend angepasst wurde.
Dass die griechische Bibel von Juden von der Antike bis ins Mittelalter und darüber hinaus rezipiert wurde, zeigt insbesondere Nicholas de Lange (de Lange 2015; 2010; 1996; Leipziger 2018).
Der aramäische TargumDie Übersetzung des Aquila ist daher ein Targum, entsprechend dem aramäischen Targum*, der eben keine schriftliche Bibel in anderer Sprache ist, sondern zunächst mündlich, dann aber auch schriftlich, die Lese- und Rezitier-Performanz des kanonisch genau geregelten hebräischen Textes auslegend begleitet. Darin ist der Targum Teil der mündlichen Tora (bTem 14b; SifDev 161; zum Ganzen Smelik 1999).
Synagogale Lesung und TargumDie Rabbinen unterschieden sehr deutlich zwischen dem Rezitieren der Tora – also der rituell bis ins Detail festgelegten Wiedergabe |11|der Wörter – und der Darlegung ihrer Bedeutung. Dies zeigt sich auch an den Vorgaben zur rituellen Performanz: Vorleser und Übersetzer ( meturggeman ) dürfen personell nicht identisch sein: Der Vorleser konzentriert sich auf die Tora-Rolle, der Übersetzer muss aus dem Gedächtnis rezitieren (Stemberger 2009, bes. 97–104). Auf dieser Linie liegt es daher auch, dass die späteren gaonäischen* Quellen wie Massekhet Sofrim und Massekhet Sefer Tora (Sof I,7 oder SefT I,6), die sich mit Schreiberregularien befassen, eine Übersetzung grundsätzlich ablehnen (Levine 1996).
Leseordnung im GottesdienstMit Beginn der rabbinischen Zeit lässt sich ein synagogaler Gottesdienst mit Schriftlesung (Tora; Propheten), Schriftauslegung und Gebet nachweisen (Leipziger 2018; Stemberger 2009, bes. 97–104; Schiffman 1999; Maier 1997; Mann 1966). Ist auch das Alter einer festen Leseordnung nicht eindeutig zu bestimmen, so ist eine solche spätestens seit der talmudischen Zeit nachweisbar (vgl. bMeg 29b), ist jedoch auch schon für die Zeit von Mischna* und Tosefta* anzunehmen, wie man an der Nennung der Abschnitte für die sog. ‚vier besonderen paraschijjot ‘ (vor Pesach: Scheqalim ; Sachor ; Para [ Aduma ]; ha-Chodesch ) erkennen kann (tMeg III,1–4.10; mMeg III,4–6).
Die ToralesungAus talmudischer Zeit sind unterschiedliche Einteilungsprinzipien für die Toralesung, die Rezitation der fünf Bücher Moses, bekannt. Der palästinischen Unterteilung in eine Leseordnung, bei der die Abschnitte ( sedarim ) auf einen dreijährigen Lesezyklus verteilt wurden, stand die babylonische mit Wochenabschnitten ( paraschijjot ) gegenüber, die auf einen einjährigen Lesezyklus zugeschnitten war und sich in nachtalmudischer Zeit auch sukzessive durchgesetzt hat. Die Mischna legt bereits fest, dass am Montag, am Donnerstag sowie am Schabbat Nachmittag Toralesung stattfinden müsse, und gibt dabei noch eine Reihe zusätzlicher Regularien an (mMeg IV,1–4).
Das Punktations- und AkzentsystemDas Punktations- und Akzentsystem, für das die sog. Masoreten und ihre Vorgänger verantwortlich zeichnen, wurde sukzessive erst ab dem 5. Jahrhundert u.Z. entwickelt. Dabei waren jeweils unterschiedliche Autoritäten an der schriftlichen Überlieferung des biblischen Textes beteiligt: Die Soferim suchten den Konsonantentext zu stabilisieren, die Naqdanim versahen den Konsonantentext mit den Punktationen für Vokalzeichen sowie den Akzentzeichen ( te‘amim ). Die Masoreten schließlich stellten die eigentliche Masora an den Rändern des Textes zusammen. Sie notierten dabei Lese- und Schreibabweichungen ebenso wie die Häufigkeit bestimmter Wörter, eine abweichende Aussprache oder andere textliche Besonderheiten. Die Masora ermöglichte einerseits eine unbedingte Fixierung des Textbestandes, andererseits jedoch auch die Notie|12|rung grammatikalischer Abweichungen oder textlicher Korruptelen. Darüber hinaus, dies zeigen neuere Studien zur Masora, waren die Masoreten auch darum bemüht, Interpretationen, die sie aus dem Midrasch* kannten und für wichtig genug erachteten, über intertextuelle Bezüge und Anspielungen im Bibeltext selbst zu verankern und auch dies in den masoretischen Anmerkungen festzuhalten (Martín-Contreras/Miralles-Maciá 2014; Martín-Contreras 2005).
Читать дальше