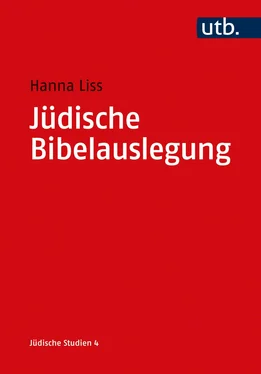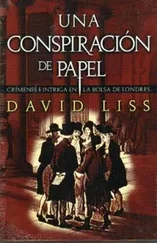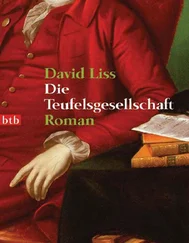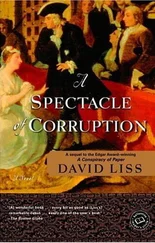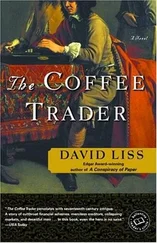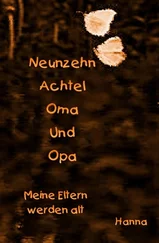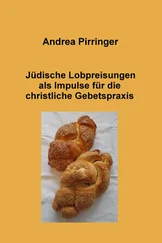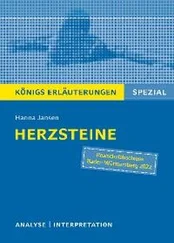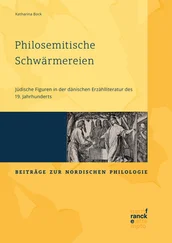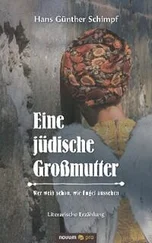Die Juden in allen geographischen Räumen schrieben ihre Bibelkommentare nicht im luftleeren Raum des theologischen Disputs, sondern nahmen in unterschiedlichem Maße Bezug auf die sie umgebenden Kulturen und Literaturen und vor allem: Sie legten die Bibel für sich als eine sich in je unterschiedlichen Kontexten befindliche Gruppe aus. Die Beschäftigung mit jüdischen Kommentaren zur Bibel bedeutet daher gleichzeitig, die intellektuelle Kreativität in unterschiedlichen Epochen und sozialen Räumen darzustellen. Jüdische Denker und Exegeten sollen also weniger als ausschließlich Reagierende auf die durch die nicht-jüdische Gesellschaft gestaltete Geschichte (Kreuzzüge; Almohadenverfolgungen; russische Pogrome; Nazideutschland) wahrgenommen werden, sondern als Autoren, die den Aufbau eigener kultureller und literarischer Räume – allen Widerständen zum Trotz – aktiv mitgestaltet haben.
Jüdische Bibelauslegung im MittelalterDas jüdische Mittelalter wird beherrscht von Persönlichkeiten wie den frühen Masoreten , den Geonim Babyloniens wie R. Sa‘adja Gaon und Schemu’el ben Chofni, für Nordfrankreich R. Schelomo Jitzchaqi (Raschi), R. Schemu’el ben Meïr (Raschbam), für Spanien und die Provence R. Avraham ibn Ezra, den Mitgliedern der Familie |3|Qimchi und R. Mosche ben Nachman (Ramban; Nachmanides). Alle diese Exegeten betrieben das Studium und die Auslegung der Bibel nicht nur als eine eigene Disziplin, die eine entsprechende Literaturgattung nach sich zog; vielmehr widmeten sie sich der Bibel auch vor einem bei den einzelnen je unterschiedlichen, aber stets explizit formulierten hermeneutischen Hintergrund und mit einem je verschieden zu bestimmenden exegetischen Anspruch (z.B. die Herausforderung durch die Karäer*, die sog. Peschat-Exegese*; die Auseinandersetzung mit der lateinischen Bibelauslegung usw.).
Die Juden in der RenaissanceDie Zeit der jüdischen Renaissance in Italien zeichnet sich dadurch aus, dass der jüdische Bibelausleger in seinem zivilen Beruf (beispielsweise als Arzt oder Financier) in die nicht-jüdische Öffentlichkeit tritt und diese Öffentlichkeit wiederum Eingang in seine Bibelkommentare findet. In der Konsequenz entstehen, ausgehend vom biblischen Text, archäologische (Azarja dei Rossi), poetologische (Messer Leon), staatspolitische (Abravanel) oder militärhistorische (Portaleone) Abhandlungen, die oftmals gar nicht mehr einem Bibelkommentar sensu stricto entsprechen. Diese Werke sind aber dennoch in Auswahl vorzustellen, um einen Eindruck davon zu vermitteln, welchen Veränderungen die Bibel und der Umgang mit ihr in diesen Zeiten ausgesetzt war.
Jüdische Bibelauslegung in Neuzeit und ModerneIm 15. und 16. Jahrhundert finden wir eine Reihe von Hebraisten und Textforschern, die sich vor allem der Masoraforschung und der Erstellung des biblischen Textes widmen. Bei dem italienischen Gelehrten Jedidja Salomon Raphael Nortzi (1560–1626; Hauptwerk Minchat Schai ; gedruckt in Mantua erst 1742) wird vor allem die orientalische Masora, die auf dem Weg über Spanien nach Italien gelangte und durch den gedruckten textus receptus* vermittelt wurde, zum Instrument für kritische Textforschung: Unter dem Einfluss des wahrscheinlich ebenfalls aus Italien stammenden Gelehrten Menachem b. Jehuda de Lonzano (1555–1624; Penkower 2014), bestand Nortzis Interesse darin, die Bibel textkritisch aufzuarbeiten. Hier hat sicher auch die Auseinandersetzung mit der christlichen Hebraistik Pate gestanden.
Im 18. Jahrhundert hatten sich die wenigen jüdischen Gelehrten, die sich mit der Bibel und nicht in erster Linie mit dem Talmud* beschäftigten, vor allem mit der beginnenden protestantischen Bibelwissenschaft auseinanderzusetzen, die sich vornehmlich der sog. ,höheren Kritik‘ verschrieben hatte (vgl. Liss 2004). Die Textkritik, die ,niedere Kritik‘, diente ausschließlich der Erarbeitung des ,besten‘ Textes, d.h. der Annäherung an einen ,Urtext‘. Demgegenüber und in deutlicher Konkurrenz zur christlichen Exegese suchte Naphtali Herz Wessely (1725–1805) wiederum unter Einbeziehung der Masora, d.h. vor allem der Vokalisierung, der Akzentsetzung und |4|weiterer Metatexte, den Bibeltext philologisch gründlich zu kommentieren. Hebräische Philologie und Auslegungstradition werden hier zusammengebunden und die Masora um ihrer exegetischen Qualität willen konsultiert.
Das 19. Jahrhundert markiert dann in Teilen endgültig die Umbruchzeit von der traditionellen jüdischen Bibelauslegung zur historisch-literaturkritischen Erforschung der Bibel bzw. die damit einhergehende Auseinandersetzung um diese sehr unterschiedlichen Auslegungsparameter. Die diese Zeit prägenden Auseinandersetzungen um das Verständnis der Hebräischen Bibel können hermeneutisch nicht hoch genug veranschlagt werden und prägen die jüdische Bibelauslegung bis heute.
2. Jüdische Bibelauslegung als Teil einer jüdischen Theologie
Bibelkommentare sind ein Produkt der Herausforderung von innen und außen: Sie sind das Ergebnis der Reflexion über eigene Überzeugungstraditionen, und sie dienen der Schärfung der religiösen und sozio-kulturellen Position. Bibelauslegung gehört daher immer in den Bereich der Theologiebildung mit hinein, auch wenn sich gerade die jüdische Bibelauslegung, wie an einer Reihe mittelalterlicher Exegeten zu zeigen sein wird, nicht auf den religiös-theologischen Raum beschränken lässt. Die Auseinandersetzung mit der Bibelkommentarliteratur ist vor allem im Zuge der sich neu formierenden theologischen Fakultäten auf jüdischer wie auch auf islamischer Seite unabdingbar, denn auch für die wissenschaftliche jüdische Theologie sind Arbeitsmaterialien und Grundlagenwerke bereitzustellen. Diese ermöglichen nicht einfach eine religionswissenschaftlich-literaturgeschichtliche und damit eine v on außen herangehende Zugangsweise, sondern stellen gleichzeitig Parameter und Denkmuster zur Verfügung, die auch den heutigen Studierenden zu einer theologischen, d.h. einer qualifizierten Urteilsbildung aus der Binnenperspektive verhelfen können.
Philologie und TheologieDie Auslegung der Hebräischen Bibel wird so auch zur theoretischen Reflexion über die Lehre und die Praxis einer bestimmten religiösen Kultur. Schon bei Philo von Alexandrien findet sich der Begriff theologéō ( theólogos ) ‚von Gott/den göttlichen Dingen reden und/oder diese erklären‘ (Schmid 2013, bes. 13–16). Für den christlichen Bereich finden wir seit der Alten Kirche den Begriff der theología (griech., Lehre von Gott ), der (neben den klassischen Bezeichnungen der sacra doctrina oder doctrina fidei ) seit dem 11. Jahrhundert das ganze Gebiet der christlichen Glaubenswissenschaften |5|umfasst. Für das rabbinische* Judentum hat es eine vergleichbare und auf den Theologiebegriff selbst bezogene Debatte nicht gegeben, das heißt aber nicht, dass ihm eine intensive theoretische Durchdringung der eigenen Text- und Lebenstradition nicht zu eigen war. Auch wäre die Annahme falsch, dass Gelehrte des Judentums nicht, wie insbesondere die muslimischen Religionsphilosophen seit dem 10. Jahrhundert, ausgeprägte metaphysische Denkgebäude und eine eigene grammatisch-linguistische Forschungstätigkeit entwickelt hätten. Vielmehr hat sich insgesamt seit dem Mittelalter das ausgebildet, was man als theoretische Reflexion über die Lehre und die Praxis definieren kann. Exemplarisch verdeutlichen lässt sich dies an den spanischen Hebraisten des 10. und 11. Jahrhunderts und den hier geführten lexikographischen Debatten: Bibelauslegung bedeutete für sie in erster Linie Untersuchungen am biblischen Wortschatz und der Grammatik und eher untergeordnet die Klärung einzelner inhaltlicher Motive oder Bedeutungsfelder. So gesehen waren die spanischen Hebraisten die ersten, die sich in ihrer Beschäftigung mit der Bibel einem kritischen Forum stellten und diese den Kategorien von richtig und falsch unterordnen wollten.
Читать дальше