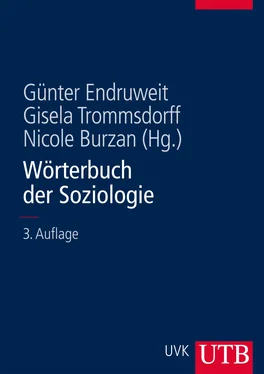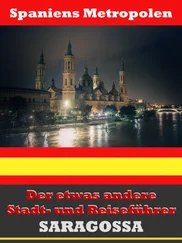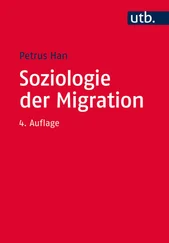Literatur
Bourdieu, Pierre, 1986: Der Kampf um die symbolische Ordnung. Pierre Bourdieu im Gespräch mit A. Honneth, H. Kocyba und B. Schwibs; in: Ästhetik und Kommunikation 62/16. – Ders., 1988: Homo academicus. Frankfurt a. M. – Ders., 1992: Rede und Antwort. Frankfurt a. M. – Ders., 1993: Über einige Eigenschaften von Feldern; in: ders. (Hg.): Soziologische Fragen, Frankfurt a. M., 107–114. – Ders., 1996: Die Logik der Felder; in: ders; Wacquant, Loïc J. D (Hg.): Reflexive Anthropologie, Frankfurt a. M., 124–147. – Ders., 1998: Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen Feldes, Konstanz. – Ders., 1999: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt a. M. – Ders., 2000: Das religiöse Feld. Texte zur Ökonomie des Heilsgeschehens, Konstanz. – Ders., 2001: Das politische Feld. Zur Kritik der politischen Vernunft, Konstanz. – Lewin, Kurt, 1982a: Feldtheorie des Lernens; in: Graumann, Carl-Friedrich (Hg.): Feldtheorie, Bern/Stuttgart, 157–185. – Lewin, Kurt, 1982b: Verhalten und Entwicklung als Funktion der Gesamtsituation; in: Weinert, Franz E.; Gundlach, Horst (Hg.): Psychologie der Entwicklung und Erziehung, Bern/ Stuttgart, 375–448. – Lewin, Kurt, 1982c: Psychologische Ökologie; in: Graumann (Hg.) [s. o.], 291–312. – Lewin, Kurt, 1982d: Feldtheorie und Experiment in der Sozialpsychologie; in: Graumann (Hg.) [s. o.], 187–213. – Lewin, Kurt (1982e): Formalisierung und Fortschritt in der Psychologie; in: Graumann (Hg.) [s. o.], 41–72. – Lohr, Winfried, 1963: Einführung zur deutschsprachigen Ausgabe; in: Cartwright, Dorwin (Hg.): Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Ausgewählte theoretische Schriften, Bern/Stuttgart, 15–42. – Schumacher, Florian, 2011: Bourdieus Kunstsoziologie, Konstanz. – Vester, Michael, 2002: Das relationale Paradigma und die politische Soziologie sozialer Klassen; in: Bittlingmayer, Uwe H. et al. (Hg.): Theorie als Kampf? Zur politischen Soziologie Pierre Bourdieus, Opladen, 61–121. – Weber, Max, 1972: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen (1921).
Florian Schumacher
Forschung
Forschung (engl. research) ist in den beiden Hälften der empirischen Sozialwissenschaften , der Theorie und der Empirie , die Tätigkeit des Wissenschaftlers im Bereich der Empirie, d. h. die Tätigkeit, durch die er mit objektspezifischen Methoden in der Wirklichkeit Erkenntnisse über sein Objekt sammelt oder auch die Suche »nach Erkenntnissen durch systemische Auswertung von Erfahrungen (›empirisch‹ aus dem Griechischen: ›auf Erfahrung beruhend‹)« (Bortz/Döring, 5).
Damit sind quantitative und qualitative Methoden gleichermaßen gemeint, aber stets grundsätzlich Methoden der Feldforschung , auch in deren Modifikation als Laborforschung , weil es auch in dieser um Erforschung am Erkenntnisobjekt geht, nur eben in einer künstlichen Situation. Ausgeschlossen ist damit die »Schreibtischforschung« (desk research im Gegensatz zu field research), die nur ein Irrtum erregender Ausdruck für Theoriearbeit ist. Diese ist entweder vor der Forschung angesiedelt, wenn es um[128] erste hypothetische Erklärungen der Forschungsfragen geht, oder nach der Forschung, wenn deren Ergebnisse für eine revidierende, nun validere Fassung der Theorie ausgewertet werden; dieser zweite Bereich ist in der Soziologie allerdings bisher völlig unterentwickelt. Damit stehen Theoriekonstruktion und Forschung in den empirischen Sozialwissenschaften in einem untrennbaren Zusammenhang, auch wenn dieser im Wissenschaftsalltag längst nicht immer beachtet wird (Babbie, 35–54; Endruweit, 66–69, 78, 125–128), u. a. auch dadurch nicht, dass Theorien i. d. R. nicht »überprüfungsorientiert« formuliert werden.
Der Grundsatz von Forschung als Feldforschung wird nur vermeintlich durchbrochen von Datensammlungsverfahren, die in der Tat am Schreibtisch, jetzt eher am Computertisch angewendet werden, so etwa bei der Inhaltsanalyse . Hierbei ist beispielsweise das eigentliche Forschungsobjekt die Sozialisationspraxis der Adelsfamilien im 17. Jh., die »im Feld« nicht mehr beobachtet oder durch Befragung erforscht werden kann, sondern die z. B. nur aus autobiografischem Material als der Wirklichkeit noch nächster Quelle ermittelt werden kann, gewissermaßen als Interview ersatz, also indirekte Feldforschung.
Über die Unterschiede zwischen qualitativer und quantitativer Forschung gibt es viele idealtypische Aussagen (vgl. z. B. die Tabellen bei Lamnek, 244, und Bortz/Döring, 299–302), die alle einige sehr fragwürdige Elemente enthalten. Ob man quantitativ oder qualitativ vorgeht, hängt nicht zuletzt davon ab, was man einerseits an Daten hat oder haben kann und was man andererseits mit den Daten aussagen will. Wenn Totalerhebungen oder Stichprobe n unmöglich sind, ist auch quantitative Forschung unmöglich. Wenn man dagegen, wie so oft, aus keiner Theorie eine Hypothese für das ins Auge gefasste Forschungsthema finden kann, ist ein qualitatives Interview manchmal weit aufschlussreicher als jede quantitative Explorationsstudie . Allerdings darf in den Sozialwissenschaften nie vom Teil auf das Ganze geschlossen werden (ebenso nicht vom Ganzen auf ein Teil), weil sie keine den Naturgesetzen entsprechende Erkenntnisse haben. Aber nicht nur zur Hypothesenfindung ist qualitative Forschung brauchbar, sondern auch zur Hypothesenprüfung, wenn es sich um Es-gibt-Hypothesen handelt (Beispiel: Es gibt nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung durch die Vergabe von Mikrokrediten). Je-desto-Hypothesen sind dagegen immer nur mit quantitativer Forschung zu überprüfen.
Das hier beschriebene Konzept von Forschung ist am Kritischen Rationalismus orientiert. Daneben gibt es noch andere Auffassungen, etwa in der Kritischen Theorie oder in der marxistischen Soziologie (dazu u. a. Friedrichs, 18–32; Aßmann/Stolberg, 30–40), die aber in der tatsächlichen Forschung schon immer eine geringe Bedeutung hatten und jetzt eine fast nur noch Historische.
Literatur
Aßmann, Georg; Stollberg, Rudhart (Hg.), 1979: Grundlagen der marxistisch-leninistischen Soziologie, Berlin. – Babbie, Earl, 1989: The Practice of Social Research, 5. ed., Belmont. – Bortz, Jürgen; Döring, Nicola, 2006: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 4. Aufl., Heidelberg. – Endruweit, Günter, 1997: Beiträge zur Soziologie, Bd. I, Kiel. – Friedrichs, Jürgen, 1990: Methoden empirischer Sozialforschung, 14. Aufl., Opladen. – Lamnek, Siegfried, 1995: Qualitative Sozialforschung, Bd. 1, 3. Aufl., Weinheim.
Günter Endruweit
Freizeit
Freizeit im sozialen Wandel
Frei zeit (engl. leisure time, free time) im 21. Jh. hat eine andere Qualität als in den Nachkriegszeiten der fünfziger und sechziger Jahre oder den Wohlstand szeiten der siebziger bis neunziger Jahre: Steigende Lebenserwartung auf der einen und sinkende Realeinkommen auf der anderen Seite lassen erwerbsfreie Lebensphase n in einem ganz anderen Licht erscheinen. Lebensstandardsicherung und soziale Ungleichheit en, Gesundheitserhaltung sowie neue Sinnorientierungen des Lebens jenseits von Konto und Karriere machen den ehemaligen »Wohlstandsfaktor Freizeit« zu einer gleichermaßen ökonomischen wie sozialen Frage: Wie kann die persönliche und gesellschaftliche Lebensqualität auch in politisch und wirtschaftlich schwierigen Krisenzeiten erhalten und nachhaltig gesichert werden? Frei verfügbare Zeit- und Lebensabschnitte werden immer mehr zur Investition in lebenslanges Lernen, in Wohlfühlkonzepte, in Familien- und Nachbarschaftshilfen, aber auch in Unterhaltungs- und Entspannungsprogramme [129]genutzt. Aus dem »Frei von« bezahlter Arbeit wird zunehmend ein »Frei für« eine lebenswerte Zukunft. Das »spart« Geld, aber »kostet« Lebenszeit.
Читать дальше