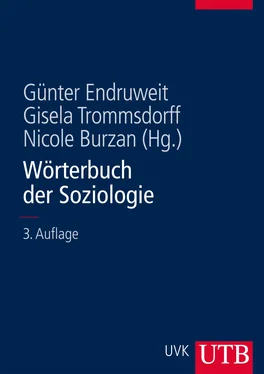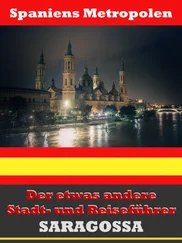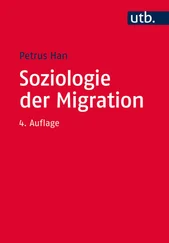Stabilität von Paarbeziehungen
Sicherlich nicht unabhängig von der Interaktion der Partner ist die Dauerhaftigkeit und Stabilität partnerschaftlicher oder ehelicher Beziehungen. Zahllose empirische Studien haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte international, aber auch in der Bundesrepublik mit den Bestimmungsgründen für das Scheitern von Paarbeziehungen und Ehen beschäftigt. Neben eher psychologisch orientierten Untersuchungen, die beispielsweise die Rolle von Interaktions- und Konfliktstilen betonen, lässt sich – wiederum auf der theoretischen Grundlage der Familienökonomie – eine Fülle sozialstruktureller Einflussfaktoren ausmachen: eine frühe Eheschließung erhöht das Trennungsrisiko, gemeinsame Kinder und andere Investitionen in sog. beziehungsspezifisches Kapital fördern hingegen die Stabilität. Neben diesen Determinanten der Stabilität rücken immer mehr auch die Konsequenzen einer Trennung in den Mittelpunkt. Hier lassen sich Folgen für die Partner sowie für die Kinder unterscheiden, ebenso sind kurzfristige und langfristige Folgen zu differenzieren. Generell sind Trennungen sicherlich ein bedeutsamer Einschnitt im Lebensverlauf , wobei vor allem die kurz- und mittelfristigen finanziellen Folgen für Frauen auch sozialpolitische Relevanz besitzen. In den letzten Jahren findet zudem die familiale Organisation nach einer Trennung und hierbei vor allem die Rolle von Alleinerziehenden und Stiefelternschaft zunehmende Aufmerksamkeit.
Zur Zukunft der Familie
Gerade in der allgemeinen Soziologie wird die Organisation privater Lebensformen häufig als Beispiel für die Folgen unterschiedlichster allgemeiner Entwicklungen wie der Urbanisierung, Modernisierung oder Differenzierung herangezogen. Je nach theoretischer und teilweise auch ideologischer Ausrichtung wird dann über die Krise oder teilweise sogar das Ende der Familie spekuliert. Wenn man seinen Blick von der kurzfristigen Veränderung einzelner demographischer Kennziffern abwendet und sowohl kulturell wie historisch seinen Blickwinkel erweitert, so kann bei aller Veränderung der konkreten Organisation familialen und privaten Lebens festgehalten werden, dass sowohl normativ wie auch konkret derartige partnerschaftliche und familiale Lebensformen ihre Bedeutung nicht verloren haben.
Literatur
Becker, Gary S., 1981: A Treatise on the Family, Cambridge/ London. – Bengtson, Vern L., 2001: Beyond the Nuclear Family: The Increasing Importance of Multigenerational Bonds; in: Journal of Marriage and the Family 63, 1–16. – Berger, Peter L., Kellner, Hansfried, 1965: Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit; in: Soziale Welt 16, 220–235. – Gestrich, Andreas et al., 2003: Geschichte der Familie, Stuttgart. – Hill, Paul B.; Kopp, Johannes, 2006: Familiensoziologie, 4. Aufl., Wiesbaden. – Kertzer, David I.; Barbagli, Marzio (Hg.), 2001: Family Life in Early Modern Times, 1500–1789. New Haven/London. – Kopp, Johannes et al., 2010: Verliebt, verlobt, verheiratet. Institutionalisierungsprozesse in Partnerschaften, Wiesbaden. – Straus, Murray A.; Gelles, Richard J. (eds.), 1990: Physical Violence in American Families. Risk Factors and Adaptations to Violence [124]in 8145 Families, New Brunswick, NJ. – Treas, Judith; Drobnic, Sonja, 2010: Dividing the Domestic. Palo Alto. – White, James M., 2005: Advancing family theories, Thousand Oaks.
Johannes Kopp
Feldforschung
Feld forschung (engl. field research) ist ein Datenerhebung sansatz, der in der Ethnologie und Anthropologie entwickelt wurde und dort immer noch vorwiegend benutzt wird. Seit einigen Jahrzehnten ist er auch in der Soziologie und der Psychologie übernommen worden.
Methodischer Ansatz
Feldforschung muss im Gegensatz zur Laborforschunggesehen werden, die als Begriff aber kaum benutzt wird. Feldforschung bedeutet dann, dass die Daten in der natürlichen Umgebung der Untersuchungspersonen erhoben werden und nicht in einer Umgebung, in die die Untersuchungspersonen nur zum Zweck der Untersuchung kommen. Ein Extrem an Laborforschung sind etwa Untersuchungen mancher empirischer Ökonomen zum lnvestitionsverhalten, bei denen man Versuchspersonen in einen Universitätsraum oder in einen gemieteten Wirtshaussaal einlädt, damit sie dort, durch Sichtblenden getrennt, mit Spielgeld Investitionsentscheidungen in verschiedenen angenommenen Konjunktursituationen fällen.
Demgegenüber sollen in der Feldforschung die Daten in der alltäglichen Umgebung der Versuchspersonen erhoben werden, weil dort alle die Faktoren auf die Versuchsperson einwirken, die auch außerhalb der Forschungssituation auf sie wirken. Am deutlichsten wird der Gegensatz beim Experiment , wo die Unterscheidung von Feld- und Laborexperiment auch gängiger Sprachgebrauch ist. lm Gegensatz zum eben skizzierten Laborexperiment zum lnvestitionsverhalten würde man in einem Feldexperiment beispielsweise Handwerkern aus verschiedenen Branchen echtes Geld geben, um zu sehen, wie sich die unterschiedliche Konjunktur der Branchen auf die Risikobereitschaft beim Investieren auswirkt.
Entsprechend dem Beginn der Feldforschung in der Ethnologie ist einer ihrer Hauptzwecke ein Vorteil für den Forscher: Er erhält Kenntnis vom sozialen (und natürlichen) Umfeld seines Forschungsgegenstandes und vermag ihn erst dadurch zutreffend zu deuten. Ethnologie ist ein interkulturelles Vorhaben. Forscher aus einer Kultur forschen über eine andere, für sie fremde Kultur. Selbst wenn sie die Sprache der beforschten Kultur fließend beherrschen sollten, kennen sie noch nicht die Bedeutung von Gesten, Traditionen, die Wirkung von Ängsten, religiösen Normen, die Rücksicht auf Bräuche, Loyalitäten usw. und geraten so in die Gefahr von Ethnozentrismus bei der Deutung ihrer Ergebnisse. Wer etwa als mitteleuropäischer Forscher nicht weiß, dass in manchen Kulturen ein deutliches Nein auf eine Frage eine ungezogene Unhöflichkeit ist und deshalb durch zurückhaltende Zustimmung ersetzt wird, der würde sich wundern, dass er auf die Frage, ob jemand bereit wäre, ehrenamtlich in einer Hilfsorganisation mitzuarbeiten, sehr oft scheinbare Bereitwilligkeit findet in Antworten wie »Wenn mich jemand fragte und ich hätte gerade Zeit übrig, wäre ich grundsätzlich sicherlich interessiert daran«, die in Wirklichkeit aber eine Verneinung bedeutet. In solchen Situationen ist die langfristige teilnehmende Beobachtung ein methodisch angezeigter Ausweg. Dabei ist aber eine große methodische Schwierigkeit, dass der Beobachter allein durch seine Teilnahme schon das Feld verändert. Das kann sich allerdings im Laufe der Zeit durch Gewöhnung des personalen Umfeldes ändern; so wurde ein Forscher, der in der Rolle des Protokollanten an den Sitzungen eines Betriebsrates teilnahm, nach Wochen stillen Mitschreibens gefragt, warum er sich aus allem heraushalte und nie seine Meinung sage, wie es sich für ein Mitglied des Betriebsrates gehöre. Eine methodisch ziemlich unproblematische, aber in ihrer Validität sehr begrenzte Datensammlungstechnik für Feldforschung ist das Informantengespräch oder- interview . Elemente von Feldforschung werden auch bei der mündlichen Befragung benutzt, wenn diese in einer Umgebung durchgeführt wird, die dem Befragungsthema entspricht, also eine Befragung zur Arbeit am Arbeitsplatz, zu Erziehungszielen am Wohnzimmer- oder ggf. am Küchentisch usw. Das soll die Forderung nach »Einheitlichkeit der (Daten-)Erhebungssituation« verwirklichen, die man bei der schriftlichen Befragung gar nicht erst erheben kann. Die Begriffe Feldphase und Feldarbeit haben nichts mit der Feldforschung zu tun. Sie bezeichnen die Datenerhebung außerhalb des Arbeitszimmers auch bei jeder Laborforschung.
[125]Vor- und Nachteile
Am geschilderten Experimentbeispiel wird deutlich: lm Laborexperiment können wir die uns hier interessierende unabhängige Untersuchungsvariable, das lnvestitionsverhalten unter verschiedenen Konjunktursituationen, schön eindeutig messen, weil alle »Störvariablen« ausgeschaltet werden können. Wir können aber die Ergebnisse nicht als Entwicklungsprognose für die Wirklichkeit verwenden, weil dort die Störvariablen nicht ausgeschaltet werden können. lm Feldexperiment haben wir diese Störvariablen (z. B. Familiensituation, Gesundheitszustand) enthalten, können aber ihren jeweiligen Anteil an der lnvestitionsentscheidung nicht bestimmen. Ein Nachteil der Feldforschung ist – neben den viel höheren Kosten und der längeren Dauer – gegenüber der Laborforschung die Gefahr, dass Forscher sich mit ihren Objekten (über-)identifizieren (»going native«, wie die Ethnologen sagen) und so das Qualitätsmerkmal der Objektivität verletzen. Repräsentativität kann in der Feldforschung nicht erreicht, nicht einmal angestrebt werden. Sie eignet sich daher – das aber hervorragend – zur Einzelfallstudie , zur Hypothese nfindung und auch überhaupt zur Darstellung des Bühnenbildes für folgende methodisch strengere Untersuchungen. Die externe Validität der Feldforschung ist sehr hoch. Feldforschung ist also weitgehend deskriptiv und qualitativ. Sie wird daher oft im Vorlauf zu quantitativen Untersuchungen durchgeführt. Verbindungen zur soziologischen Theorie bestehen u. a. darin, dass die Feldforschung manche Überlegungen Max Webers zur Verstehenden Soziologie aufgegriffen hat. Andererseits hat sich der Symbolische lnteraktionismus Gedanken der Feldforschung zur Grundlage gemacht; in dieser Beziehung war die Feldforschung wohl fruchtbarer als alle quantitativen Methoden .
Читать дальше