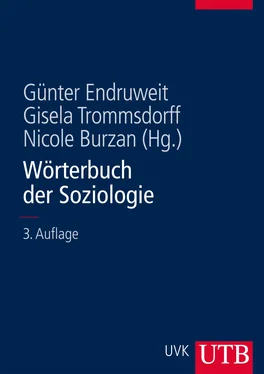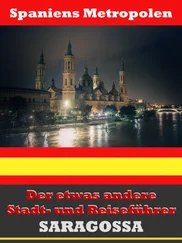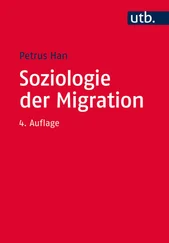Beispiele für Feldforschung
Zu den einflussreichsten Werken der Feldforschung gehören die Untersuchungen von A. R. Radcliffe-Brown (The Andaman lslanders. 1922), B. Malinowski (Argonauts of the Western Pacific, 1922) und Feldforschung Boas mit seinen Forschungen über die Eskimos (ab 1886) und die lndianer-Studien seiner Schüler. Alle drei waren Mitbegründer der Ethnologie, die beiden Ersten waren ihrerseits beeinflusst von dem Soziologen Emile Durkheim. Die Soziologie nahm ihre Anregungen für Feldforschung vor allem von diesen Arbeiten auf, nicht zuletzt wegen der methodologischen Einleitung von Malinowski. Ebenfalls ethnologisch waren die Feldforschungen, die M. Mead ab 1931 in Neuguinea durchführte und die viele methodologische Diskussionen auslösten. Vor diesen Anstößen aus dem lndischen bzw. Pazifischen Ozean gab es eigentlich schon geeignete Anregungen aus Europa, so etwa von W. H. von Riehl und C. Booth.
Aber der erste Autor war Schriftsteller, Journalist, Theater- und Museumsdirektor, und der Zweite war Geschäftsmann und Sozialpolitiker, und ihre Werke waren weniger wissenschaftlich als sozialpolitisch ausgerichtet. Bahnbrechend für die moderne soziologische Feldforschung war die » Chicagoer Schule « in den USA. Zugleich mit der Begründung der Stadtsoziologie wurden dort Subkultur en erforscht. Als Beispiele sind zu nennen: W. I. Thomas: The Polish Peasant in Europe and America (1918–1922); The Unadjusted Girl (1923); R. E. Park: The Press and lts Control (1922); L. Wirth: The Ghetto (1922); P. G. Cressey: The Taxi-Dance Hall (1932). Hier entstand auch die Verbindung zum Symbolischen lnteraktionismus . Eine ebenfalls viele Folgestudien anregende Feldforschung unternahm W. F. Whyte, der vier Jahre unter Jugendlichen in einem italienischen Stadtteil von Boston zubrachte und die Ergebnisse 1943 im Buch »Street Corner Society« veröffentlichte. Auch hier ist der methodologische Anhang noch heute interessant. lm deutschsprachigen Raum war die Marienthal-Studie von M. Jahoda, P. Lazarsfeld und H. Zeisel ein Pionier der Feldforschung. Diese psychologisch-soziologische Untersuchung aus einer Zeit, als die beiden Fächer noch nicht so säuberlich geschieden waren, beschreibt das Leben von einzelnen Menschen und Familien in einem niederösterreichischen Dorf, nachdem der beherrschende Betrieb geschlossen worden war und praktisch alle Bewohner arbeitslos waren. Um einen Eindruck von der Vielfalt der Feldforschung zu erhalten, seien hier die Datenquellen aufgezählt: Karteikarten für jeden der 1.486 Einwohner mit allen erreichbaren Daten; Lebensgeschichten von 62 Personen; Zeitverwendungsbögen; Anzeigen und Beschwerden; Schulaufsätze, u. a. über Berufswünsche; Preisausschreiben für Jugendliche über Zukunftsvorstellungen; lnventare der Mahlzeiten in 40 Familien; Protokolle über Weihnachtsgeschenke, Gesprächsthemen in Läden, Umsätze in Geschäften[126] und der Gastwirtschaft usw.; Statistiken über den Konsumverein, Bibliotheksentleihungen, Vereinsmitgliedschaften usw.; historische Angaben über Fabrik, Gewerkschaften, Parteien usw.; Bevölkerungsstatistik; Erkundungen durch teilnehmende Beobachtung in Parteien, Zuschneidekurs, Arztsprechstunden, Mädchenturnkurs und Erziehungsberatung. Aus der neueren Feldforschung sind vor allem die zahlreichen Studien von R. Girtler über die verschiedensten Subkulturen zu nennen, von Prostituierten über Polizeibeamte, Stadtstreicher, Wilderer bis zu den Nachfahren des ehemaligen österreichischen Adels. Für die französische Soziologie wurden besonders die Feldforschungen von P. Bourdieu in Algerien wichtig, sowohl methodisch wie theoretisch.
Literatur
Booth, Charles, 1891–1903: Life and Labour of the People of London, 17 Bde., London. – Girtler, Roland, 2001: Methoden der Feldforschung, Stuttgart. – Jahoda, Marie et al., 1960: Die Arbeitslosen von Marienthal, Allensbach/ Bonn. – Riehl, Wilhelm H. von, 1851–1869: Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Socialpolitik, 4 Bde., Stuttgart. – Sutterlüty, Ferdinand; lmbusch, Peter (Hg.), 2008: Abenteuer Feldforschung. Soziologen erzählen, Frankfurt a. M. – Whyte, William F., 1943: The Street Corner Society, Chicago (dt. 1996).
Günter Endruweit
Feldtheorie
Die sozialwissenschaftliche Entwicklung der Feldtheorie (engl. field theory) basiert auf der Übertragung der physikalischen Entdeckungen des elektromagnetischen Feldes und des Gravitationsfeldes. Diese natürlichen Felder sind Kraftfelder, innerhalb derer Objekte ihre Positionen durch auf sie einwirkende Kräfte erhalten. Bereits seit Galilei wird die Erde nicht mehr als das Zentrum des Universums verstanden, sondern erhält nach Newton eine relative Position innerhalb eines Systems von Planeten. Die Position wird damit durch die Gravitationskräfte der Planeten bestimmt. Übertragen auf den sozialwissenschaftlichen Bereich bedeutet dies, dass die soziale Position eines Menschen nicht auf das Individuum selbst zurückgeführt werden kann, sondern durch ein soziales bzw. gesellschaftliches Kraftfeld bestimmt wird.
Der erste sozialwissenschaftliche Feldbegriff geht auf Kurt Lewin zurück, der ab den 1920er Jahren für seine Sozialpsychologie einen mikrosoziologischenFeldbegriff entwarf. Lewins Ziel bestand darin, mithilfe der Konzeption eines psychologischen Feldes das Verhalten von einzelnen Menschen zu erklären. Demzufolge sind Menschen von einem Kraftfeld umgeben, auf das ihr Verhalten zurückgeführt werden muss (Lewin 1982a: 159). Das den Menschen umgebende Feld besteht für Lewin aus zwei Teilen: der psychologischen Umwelt, also dem Lebensraum oder der sozialen Welt, und der psychologischen Innenperspektive der Person, also ihren inneren Motiven zu einem bestimmten Verhalten, das sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit und den Erwartungen an die Zukunft ergibt (Lewin 1982d: 196 ff., 1982b: 375 ff.). Somit bilden die Person und ihre Umwelt zusammen die beiden Teile eines dynamischen psychologischen Feldes (Lewin 1982c: 294, 1982d: 207).
Die Struktur dieses Feldes betrachtet Lewin als dynamisch, weil es aus einer Reihe von gerichteten Kräften besteht, den Vektoren (Lewin 1982e: 68, Vester 2002: 62). Das Verhalten einer Person ergibt sich aus allen zu einem bestimmten Zeitpunkt wirkenden Kräften des psychologischen Feldes. Lewin spricht dabei von einer Konstellation oder Topologie (Lohr 1963: 24 f.). Mit seiner Konzeption des psychologischen Feldes intendiert Lewin zwar vorrangig die Beschreibung der psychologischen Innenperspektive, jedoch denkt er dabei explizit auch das äußere soziale Umfeld einer Person mit (Lewin 1982a: 160, 1982d: 187 ff.).
Unter anderem auf der Basis von Lewins Feldkonzeption entwickelte Pierre Bourdieu einen makrosoziologischenFeldbegriff (Bourdieu 1993, 1996). Die theoretische Grundkonzeption des Feldes entwickelte Bourdieu in Auseinandersetzung mit Max Webers Religionssoziologie (Weber 1972: 245–381, Bourdieu 1986: 156). Weber analysierte darin, dass der Prozess zur Produktion, Reproduktion und Verbreitung religiöser Güter von der sozioökonomischen Entwicklung der Gesellschaft relativ unabhängig verlief, weshalb er den Bereich der Religion als »relativ autonomes religiöses Feld« veranschaulichte (Bourdieu 2000: 53). Bourdieu analysierte im Rahmen seiner Feldtheorie eine Reihe von sozialen Bereichen als Felder. Neben dem religiösen Feld widmete [127]er dem wissenschaftlichen (Bourdieu 1988, 1998) dem künstlerischen (1999) und dem politischen Feld (2001) jeweils eigene Untersuchungen.
Zudem übernahm auch Bourdieu für seine Feldkonzeption das physikalische Paradigma, also die Vorstellung des Feldes als Kräftefeld: Entsprechend der Feststellung in der Physik, »dass die Sterne nicht auf einem Gerüst hängen, sondern miteinander ein bewegtes Energiefeld bilden«, ist ein soziales Feld bei Bourdieu nicht einfach ein feststehendes, hierarchisch geordnetes »Klettergerüst« der sozialen Positionen, sondern ein Kräftefeld, das erst durch den Kampf der sozialen Akteur/innen untereinander zustande kommt (Vester 2002: 63). Soziale Felder erhalten ihre Struktur also erst durch konkurrierende Positionen von Akteur/innen (Bourdieu 1993: 107). Eine Position auf einem Feld ergibt sich dem zufolge in Relation bzw. Abgrenzung zu anderen Positionen. Damit ist ein Feld »ein Netz oder eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen« (Bourdieu 1996: 127). Soziale Felder sind folglich Arenen, in denen Konkurrent/innen um die Bewahrung und Veränderung der Struktur des jeweiligen Kräftefeldes kämpfen: »Das generierende und vereinheitlichende Prinzip dieses ›Systems‹ ist der Kampf selbst.« (Bourdieu 1999: 368). Zwar nehmen die Kämpfe auf den unterschiedlichen Feldern unterschiedliche Formen an, jedoch besteht die Grundstruktur immer in der feldinternen Auseinandersetzungen zwischen den auf dem Feld Etablierten, den Herrschenden, und den Anwärter/innen auf die Herrschaft (Bourdieu 1993: 107). Die etablierten Akteur/innen mit den höchsten Positionen neigen unter den gegebenen Kräfteverhältnissen zum Konservativismus, d. h. zu Erhaltungsstrategien, während die Akteur/innen mit niedrigen Positionen zu feldinternen Revolutionen und Umsturzstrategien tendieren (Schumacher 2011: 140).
Читать дальше