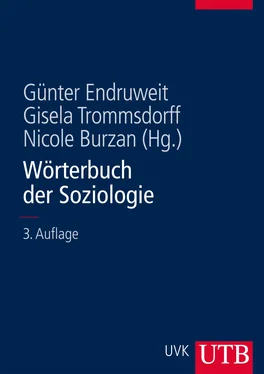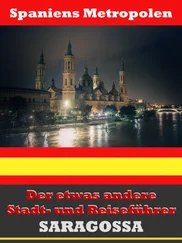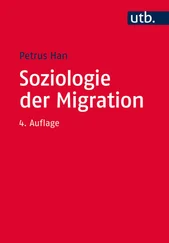Theoretische Perspektiven der Familienforschung
Wenn man von eher soziographischen Versuchen der Erfassung unterschiedlicher Lebensformen innerhalb einer funktionalistisch orientierten Sozialanthropologie und ihren mikrotheoretischen Fortsetzungen in einzelnen Milieustudien absieht, so dominieren heute vor allem theoretische Überlegungen aus dem Bereich der Handlungs - und Austauschtheorie , die zugleich eine Lebensverlauf sperspektive einnehmen (vgl. als Überblick Hill/Kopp 2006; White 2005). Besonders hervorzuheben sind dabei die Überlegungen der Familienökonomie bzw. der »new home economics« (Becker 1981), die die vielfältigsten Aspekte menschlichen Sozialverhaltens mit Hilfe eines gemeinsamen handlungstheoretisch fundierten Rahmens erklären. Die Bedeutung der verschiedenen theoretischen Ansätze lässt sich jedoch am besten anhand ihrer Erklärungsleistung hinsichtlich konkreter Beziehungs- und Familienprozesse beurteilen. Hierzu werden im Folgenden die wichtigsten Schritte in diesen Abläufen nacheinander betrachtet und einige empirische Befunde berichtet – ohne dabei jedoch auf die Details der theoretischen Argumente und empirischen Analysen eingehen zu können.
Die Entstehung und Verfestigung von Partnerschaften und die Wahl der Lebensform
Es erscheint unbestritten, dass der Wunsch nach einer romantischen Beziehung sicherlich zu den Universalien menschlichen Daseins gehört. Soziologisch interessant sind dann die Umstände der Partnerwahl sowie die ersten Entwicklungsschritte von Partnerschaften. Auch wenn sich innerhalb der Psychologie ab und an Versuche finden, die Entstehung einer konkreten Liebe s- und Paarbeziehung zu erklären, so liegt das Augenmerk soziologischer Forschungen doch eher auf strukturellen Gemeinsamkeiten. Wenn allein die sicherlich bedeutsame ›romantische Liebe‹ die Entstehung von Partnerschaften bestimmen würde, wäre die in vielen Dimensionen beobachtbare Ähnlichkeit zwischen den Partnern nicht erklärbar. Sozialstrukturell homogene Partnerschaftsmärkte – hier ist nur an die Bildungsinstitutionen zu denken – und die Partnerwahl im engeren sozialen Umfeld bilden dabei wichtige Ergänzungen. Gerade in der ersten Phase der Partnerschaftsentwicklungen sind dabei vielfältige kleine Schritte der Institutionalisierung beobachtbar, die letztlich auch als Investitionen in die Beziehung verstanden werden können, die dann wiederum ihre Stabilität erhöhen (Kopp et al. 2010). Trotz aller Vermutungen finden sich kaum verlässliche Daten, die eine Aussage über das Alter bei Beginn der ersten Liebesbeziehung im Zeitvergleich erlauben. Erste Hinweise sprechen dafür, dass sich in den letzten Jahrzehnten keine dramatischen Veränderungen beobachten lassen. Analytisch sind mit der Paarbildung und dem entsprechenden gegenseitigen Commitment, der Gründung eines gemeinsamen Haushaltes, der Heirat und der Geburt eines Kindes verschiedene Dimensionen der Verfestigung von Partnerschaften zu unterscheiden. Während bis in die 1970er Jahre in der Bundesrepublik diese Prozesse relativ zeitnah stattgefunden haben, lassen sich heute vielfältige Unterschiede, vor allem aber klare zeitliche Muster ausmachen. Während [122]die Aufnahme sexueller Beziehungen und das Commitment zu dieser Beziehung relativ zeitnah und rasch stattfinden, erfolgt die Gründung eines gemeinsamen Haushaltes und damit einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung. Ein wichtiger Erklärungsfaktor ist dabei sicherlich neben allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungstrends die durch die Bildungsexpansion bedingte späte und unsichere berufliche Platzierung beider Partner. Besonders hervorzuheben ist aber, dass diese Phase des nichtehelichen Zusammenlebens heute immer mehr zum Lebenslauf gehört und nicht immer durch eine Eheschließung beendet wird. Als Dimensionen dieser Entscheidung zwischen Partnerschaften mit getrennten oder gemeinsamen Haushalten werden die Möglichkeiten gemeinsamer Aktivitäten, die – berufs- oder ausbildungsbedingten – Opportunitäten, aber auch der Wunsch nach einer weiteren Verfestigung der Partnerschaft genannt. Ergänzend muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass derartige Fragestellungen eine biographische und lebensverlaufsorientierte Herangehensweise und vor allem entsprechende Daten nötig machen. Trotz vielerlei Fortschritte ist hier ein deutliches Forschungsdefizit zu konstatieren.
Der Übergang zur Ehe
Trotz der zunehmenden Verbreitung nichtehelicher Lebensgemeinschaften stellt die Ehe keine überholte Institution dar, sondern ist ein fester Bestandteil der Lebensplanung der meisten Menschen. Immer mehr wird die Eheschließung dabei mit der Familiengründung, also mit der Geburt eines ersten Kindes, verbunden. Neben normativen Aspekten und dem subjektiv vielleicht wichtigsten Motiv der Liebe spielen dabei auch Überlegungen eine Rolle, die sich auf die rechtliche Absicherung der durch die neue Lebenssituation entstandenen Unsicherheiten beziehen. Ehen stellen darüber hinaus den verfestigten institutionellen Rahmen, das ›nomoserzeugende Instrument‹, in dem Paare ihre jeweils eigene Lebenswelt bilden, dar (Berger/Kellner 1965). Immer noch wird zudem ein traditionelles Familienmodell durch sozialstaatliche Regelungen unterstützt. Trotz aller Angleichungsprozesse lassen sich hinsichtlich der verschiedenen partnerschaftlichen und familialen Prozesse deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, aber auch im internationalen Vergleich feststellen. So scheinen sowohl in den skandinavischen Ländern als auch in Ostdeutschland nichteheliche Lebensgemeinschaften als dauerhafte Alternative zur Ehe eher Verbreitung zu finden als in den südeuropäischen Ländern und Westdeutschland.
Familiengründung und -erweiterung
In der Zwischenzeit stellt die Familiengründung, also die Geburt eines ersten Kindes, den bedeutsamsten Schritt in der Familienbiographie dar. Im historischen Vergleich ist dabei sowohl eine Veränderung des Timings festzustellen, bedingt durch die deutliche Bildungsexpansion gerade von Frauen und den damit verbundenen längeren Zeitraum bis zur Etablierung einer eigenen beruflichen Position, als auch ein Rückgang der Geburtenzahlen. Genauere Analysen lassen jedoch vermuten, dass dieser historische Rückgang vor allem die Geburten höherer Parität betrifft und deshalb trotz der sicherlich steigenden Anzahl von dauerhaft kinderlosen Frauen die Geburt eines Kindes immer noch zum Lebenslauf der meisten Frauen gehört. Weitere Analysen befassen sich mit der Familienerweiterung und hierbei vor allem mit der Geburt eines zweiten Kindes und untersuchen dabei unter anderem den Zeitabstand zwischen den Geburten sowie Bestimmungsgründe der Familienerweiterung und die damit einhergehenden Änderungen in der Familie wie beispielsweise die – geschlechtsspezifisch unterschiedlichen – Konsequenzen für das Erwerbsverhalten oder für die innerfamiliale Teilung der häuslichen Arbeit.
Interaktion in Partnerschaft und Familie
Neben diesen auch demographisch interessanten Phänomenen – Wahl der Lebensform, Heirat und Fertilität – beschäftigt sich die Familienforschung mit den internen Prozessen in Partnerschaften und Familien. Ein wichtiges Forschungsfeld in diesem Zusammenhang bilden Analysen zur emotionalen Grundlage der Beziehung und zur Erklärung entsprechender Veränderungen im Zeitverlauf. So finden sich Studien, die einen Wandel in der Grundlage der Beziehung – ein Rückgang der romantischen und eine Zunahme der sogenannten kameradschaftlichen Liebe – diagnostizieren, aber auch Arbeiten, die generell einen u-förmigen Verlauf des Eheglücks im Beziehungsablauf feststellen. Eine Schwierigkeit[123] vieler dieser Analysen ist auch hier wiederum die fehlende längsschnittliche Datenbasis. Trotz ihrer letztendlich sicherlich gegebenen Alltäglichkeit sind ernstzunehmende Studien zur Sexualität , aber auch zu Konflikten in Partnerschaften selten. Im Gegensatz hierzu, sind die Determinanten innerfamilialer Arbeitsteilung empirisch relativ deutlich: so finden sich zahlreiche Belege, dass die von der Familienökonomie formulierten Hypothesen – die Arbeitsteilung sollte mit den relativen Ressourcen und Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt korrelieren – zutreffen, gleichzeitig erklären sie das Phänomen ungleicher Arbeitsteilung nur partiell. Offensichtlich spielen normative oder machtorientierte Motive ebenfalls eine große Rolle (Treas/Dronic 2010). Neben dieser paarbezogenen Perspektive stehen vielfach auch die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und neuerdings auch zwischen Großeltern und Enkeln sowie vereinzelt zwischen Geschwistern oder Beziehungen zur erweiterten Verwandtschaft im Mittelpunkt. Neben Untersuchungen zur (frühkindlichen) Bindung und Sozialisation werden dabei vor allem die Bestimmungsfaktoren der intergenerationalen Beziehungen im Erwachsenenalter und die Interdependenz der einzelnen Dimensionen dieser Beziehung fokussiert (vgl. Bengtson 2001). Einen letzten Themenbereich bilden Studien zur Macht verteilung in Beziehungen, aber auch zur Gewalt in Partnerschaft und Familie. Vor allem in den Vereinigten Staaten werden hierzu Studien durchgeführt, die verschiedene Risikofaktoren für Gewalt in Beziehungen herausarbeiten (Straus/Gelles 1990).
Читать дальше