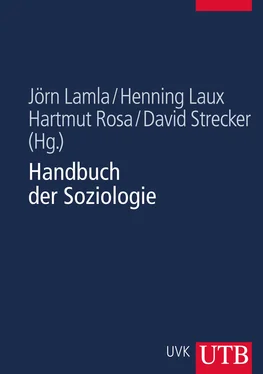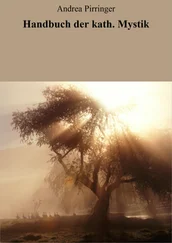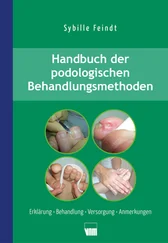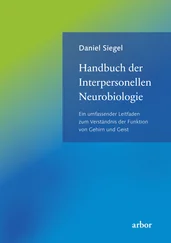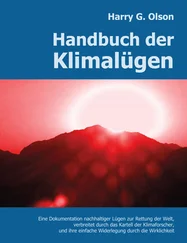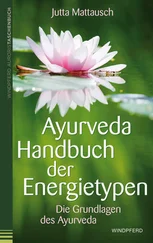1 ...7 8 9 11 12 13 ...47 3. Wenn es um die historischen Quellen soziologischen Denkens geht, kann man drittens auch den Blick auf historische Paradigmen der redundanten Denkformen und Sprachspiele lenken, die in allen Bereichen des Wissens in einem Zeitraum von mittlerer Dauer ihre Anwendung finden. Hier ließe sich von politischen Sprachen im Sinne von John G. A. Pocock sprechen, von den verbreiteten Arten, etwas zu problematisieren oder nicht, von den Konventionen der Rhetorik, dem Stil der Plausibilisierung und dem Sortiment von Vokabeln, das eingesetzt wird (Pocock 2010).
Eine solche Analyse lässt sich auch mit Blick auf eine historische Diskursanalyse erweitern, wie wir sie Michel Foucault für die Grammatik, die Klassifikation der Lebewesen und für die Analyse der Reichtümer verdanken, bevor sich das Wissen in Disziplinen der empirischen Felder »Arbeit«, »Leben« und »Sprache« ausdifferenziert hat (Foucault 1974). Auf dieser Ebene von Denkrahmen, bei Foucault episteme genannt, geht es nicht mehr um Autoren, sondern um mögliche Subjektpositionen und Gegenstandsfelder, die die Ordnung des Diskurses zulässt oder nicht.
Alles in allem: Soziologie vor der Soziologie bereitet einige Mühe und bedarf besonderer Anstrengungen, weil Soziologie ein spätes Fach ist, gerade mal gut 100 Jahre alt. Hinzu kommt, dass Soziologen nicht so vorgehen können wie etwa Physiker oder Chemiker, die in den Schriften von Gelehrten und Philosophen früherer Zeit exakt zwischen wahren Einsichten und horrendem Unsinn unterscheiden können, weil für sie der heutige Stand des Wissens maßgeblich ist. In der Soziologie verbietet sich dieses einfache Verfahren. Denn wenn es z. B. um die Validität von Aussagen über Blei geht, so nehmen wir an, dass sich dieser Reinstoff seit langer Zeit nicht verändert hat und das Wachstum des richtigen Wissens und die Bestimmung der Irrtümer auf dem Weg des Experiments gesichert werden kann. Bei Menschen, in Gesellschaft lebend, ändern sich die Dinge. So verfährt denn auch die soziologische Erforschung der Wissenschaftsgeschichte der Naturforschung nach dem Symmetrieprinzip, das lautet: Wahrheit und Irrtum der Wissenschaft einer Zeit sollen mit denselben Begriffen, Ursachen, Faktoren – d. h. eben symmetrisch – erklärt werden. Newtons Irrtümer und seine Durchbrüche sollten gerechterweise mit dem gleichen Maß gemessen werden, weil man sonst den offenen Charakter von Wissenschaft, bei dem ja gerade nicht von vornherein feststeht, was spätere Generationen gebrauchen und anerkennen können und was nicht, grundsätzlich verfehlt (Bloor 1991).
Sich mit den historischen Quellen soziologischen Denkens zu befassen, ist gerade in Deutschland auch aus politischen Gründen von Bedeutung. Denn im Selbstbewusstsein hiesiger Bürger fehlt eine verlässliche politische Konzeption mythischen Charakters, die helfen könnte, im Fluss der Ereignisse, der Krisen und Glücksmomente wieder zur Ruhe zu kommen. Helmuth Plessner hat daran erinnert, dass das Parlament in England, die bürgerliche Emanzipation in Frankreich, die erste bürgerliche Republik in Holland nicht einfach nur wichtige historische Ereignisse und [28]Prozesse darstellten, sondern es sich jeweils um nationale »Grundmythen« handelt. Plessner bemerkt dazu: »Uns fehlt eine solche Grundmythe und infolgedessen eine spezifisch bindende Tradition. Gerade deshalb sind wir das Volk der Geschichte geworden.« (Plessner 1982: 255)
Auch wenn seit 1945 unser historisches Bewusstsein auf Nationalsozialismus, Krieg und Holocaust konzentriert ist – für alle Gesellschaften gilt, dass sie zur Bewältigung ihrer Krisen die guten Geister der Vergangenheit zu Hilfe rufen und den Beistand der Ahnen in Ritualen von Erinnerungskultur erbitten. Für die Krise Europas gilt dies Erfordernis heute in besonderem Maße, geschichtslose Selbstherrlichkeit kann sich dieser Kontinent im Unterschied zu den USA nicht leisten. Denn dort kann man sich auf andere Mythen verlassen und wie Huckleberry Finn auf die Bildungsangebote der Witwe Douglas reagieren: »After supper she got out her book and learned me about Moses and the Bulrushers, and I was in a sweat to find out all about him; but by and by she let it out that Moses had been dead a considerable long time; so then I didn’t care no more about him, because I don’t take no stock in dead people.« (Twain 1885: 2)
Wir beschränken uns in diesem Beitrag auf die Soziologie vor der Soziologie und behandeln das Denken der Gesellschaft bis zu jenem Moment, an dem die heute als Gründerväter der Soziologie gefeierten Autoren Émile Durkheim, Georg Simmel, Max Weber, Vilfredo Pareto, George Herbert Mead u. a. ihre Arbeit aufnehmen.
| 2. |
Entdeckung der Gesellschaft |
Die Entstehung von Soziologie zum Ende des 19. Jahrhunderts ist mit dem eigenartigen Vorgang der Entdeckung der Gesellschaft untrennbar verbunden. Dies meint nun nicht, dass unsere ferneren Vorfahren sich nicht bewusst gewesen wären, dass Menschen in Gesellschaft leben. Sie wussten sehr wohl, dass Menschen, so wie sie ihr Leben führen, einander brauchen. Es war völlig selbstverständlich, dass, wie der Grieche Aristoteles schrieb, der Mensch ein zoon politikon ist – ein Tier sicherlich, aber ein solches, das sich zu einer politisch-gesellschaftlichen Lebensform erheben kann. Die Entdeckung der Gesellschaft im 19. Jahrhundert bezeichnet jenen Vorgang, mit dem eine alte Selbstverständlichkeit von gesellschaftlich-gemeinschaftlicher Seinsweise brüchig wird und Gesellschaft als ein Problem erscheint, für das es neue Lösungen zu finden gilt. Soziologen haben die Gesellschaft nicht aus heiterem Himmel entdeckt, sondern unter einem düsteren Himmel den Aufruhr ihrer Zeit erfahren und sich als soziales Problem versucht verständlich zu machen. Von daher steht soziologische Arbeit immer unter »Zeitdruck« im mehrfachen Sinne. Die Zeit ist zu knapp für das gemächliche Ausreifen der Forschungsergebnisse, und die Zeit bedrückt mit ihren ideologischen Verblendungen ebenso wie mit ihren Ratlosigkeiten.
Gegen diese historische Situierung der Entdeckung der Gesellschaft könnte jemand mit gutem philosophischen Sinn einwenden: Menschen haben doch immer dieselben Probleme gehabt. Dies ist eine sehr ehrenwerte und auch weise Auffassung. Wenn man auf einen hohen Berg steigt und in der klaren Luft einsam stehend über die Welt nachdenkt, wird man wohl zu solchen Auffassungen kommen. Aber unten in den Tälern und Niederungen, da wo sich Soziologinnen und Soziologen aufhalten, stellen sich die Dinge anders dar. Hier gibt es schon ewige Grundprobleme, aber es gibt vor allem Probleme, die auf den Nägeln brennen, angesichts derer man die nicht so relevanten Probleme und Prioritäten durchaus zeitweise vergessen kann. Im 19. Jahrhundert ist das Problem Gesellschaft ein auf den Nägeln brennendes Problem. Denn die lebensweltlichen Gewissheiten der frühen Moderne fallen einem vierfachen Angriff zum Opfer: der Revolutionierung der Politik, der Monetarisierung der Beziehungen, der Industrialisierung der Arbeit und der Autonomisierung der Kunst.
[29] Revolutionierung der Politik: Mit der Französischen Revolution, die 1789 beginnt und deren Ideen der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sich in der Folgezeit in der Welt auszubreiten beginnen, geht die lange Dauer einer in Stände gegliederten Gesellschaft zu Ende. Das große Muster sozialer Differenzierung war, wenn man den Blick auf den indo-europäischen Kulturkreis eingrenzt, bis dahin erstaunlich konstant. Die historischen Erzählungen berichten von der Vollkommenheit der Gliederung der Gesellschaft in drei Hauptfunktionen: 1. dem göttlichen Gesetz, das zur Ordnung zurückführt, 2. dem bewehrten Arm, der mit Gewalt zum Gehorsam zwingt, und 3. der Fruchtbarkeit der Arbeit, der Fülle und der Feste. Die vollkommene Gesellschaft teilt sich in drei Stände: Geistlichkeit, Adel und Dritter Stand. Der dem Adel entstammende und vom Bischof gesalbte Monarch bildet die Spitze des ständisch gegliederten Gemeinwesens.
Читать дальше