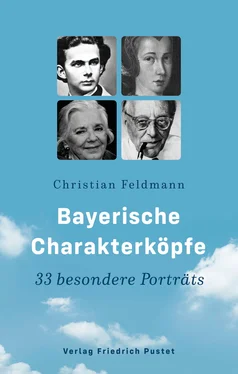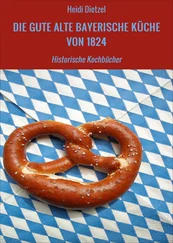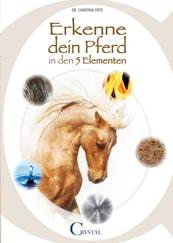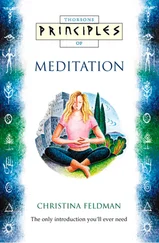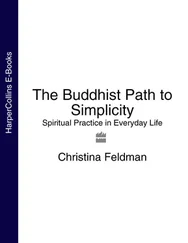Jedenfalls ging Maria Leopoldine mit ihrem Nachwuchs erheblich aufmerksamer und herzlicher um, als es damals in ihren Kreisen üblich war. Für die Kindergeburtstage und Faschingskinderbälle engagierte sie Zauberer und lud – zum Ärgernis der vornehmen Gesellschaft – auch Handwerkerkinder ein, die sie mit Schweinsbraten und Bier bewirtete. Mit der leeren Hektik des Münchner Hoflebens konnte die Kurfürstinwitwe wenig anfangen:

Arme Sterbliche, die sich Prinzen und Prinzessinnen nennen! Ich bemitleide sie inmitten ihrer Reichtümer, von Ehren umgeben, die Langweile überwältigt sie und sie verlieren das einzige wahre Glück des Lebens, das nichts zu ersetzen vermag, wenn man dessen beraubt ist, das sind die wirklichen Beziehungen wahrer, aufrichtiger, selbstloser Freundschaft, die nur auf gleichgestellter Basis bestehen können.“
Wie es sie anödete, das Leben bei Hofe, „das alle Einfälle erstickt und den Mund nur öffnen lässt, um eine Schmeichelei oder einen Gemeinplatz zu sagen!“ Maria Leopoldine dagegen liebte es, ihre Meinung unbekümmert um gesellschaftliche Konventionen kundzutun. August Graf von Platen, Page am Königshof und Schöpfer melancholischer Sonette, schwärmt von ihrem ungezwungenen, absolut unaffektierten Benehmen.
Geizig, hilfsbereit, rebellisch
Alle Berichte der Augenzeugen durchzieht jetzt allerdings die Kritik an Maria Leopoldines sprichwörtlichem Geiz. Auf ihren Faschingsbällen froren und hungerten die – wohl nur aus Pflichtbewusstsein erschienenen – Gäste. Die Speisen wurden in atemberaubendem Tempo auf- und wieder abgetragen, die Räume waren nicht geheizt, und die Maria-Leopoldine-Forscherin Krauss-Meyl hat sicher Recht, wenn sie schreibt: „Alle waren froh, wenn die Lichter allmählich verloschen und man sich empfehlen konnte, um sich an anderem Ort aufzuwärmen und sattzuessen.“
Maria Leopoldine selbst verstand nicht recht, warum die Leute sich so über etwas aufregten, was sie für die ganz normale Sparsamkeit einer guten Hausfrau hielt. Schachern und Spekulieren war ihr ein Lebenselixier geworden. In ihren Privatgemächern stapelten sich die Geschäftsbücher, Schuldenregister und Bilanzen wie bei anderen Damen der Gesellschaft die Liebesromane und galanten Journale. Auf ihren Reisen stritt sie wie ein keifendes Marktweib um die Übernachtungstarife, so dass die begleitenden Hoffräulein vor Scham in den Boden versinken wollten.
Mit ihrem raffinierten Geschäftssinn häufte die Kurfürstinwitwe ein riesiges Vermögen an, kaufte Landgüter und Brauereien auf, unterhielt Jahrmarktsbuden und ein Textilgeschäft am Münchner Maxtor, wo sie zum Entsetzen der Hofgesellschaft bisweilen hinter dem Ladentisch stand, fuhr von einem Vieh- und Getreidemarkt zum nächsten, begleitete ihre Holzflöße in eigener Person den Lech und Inn hinab, in derben Stiefeln und resolut Kommandos gebend, jonglierte dann wieder mit Wertpapieren und Aktien wie ein mit allen Wassern gewaschener Makler. 1837 gewann sie an der Pariser Börse, wo sie mit Eisenbahnaktien spekulierte, auf einen Schlag eine Million Gulden.
Gemeinsam mit ihrem Schwager, dem Grafen Montgelas, mischte sie aber auch bei anrüchigen Finanzoperationen mit. Zwei Münchner Großbankiers mussten daraufhin Bankrott anmelden, einer der beiden beging Selbstmord. Andererseits bewies Maria Leopoldine ein soziales Bewusstsein, das weit über die Attitüde der edlen Spenderin hinausging. Sie knauserte bei Galadiners und Tanzabenden, gab aber gern beträchtliche Teile ihres Vermögens für gemeinnützige Projekte her: Den großzügigen Erweiterungsbau des Frauenkrankenhauses Neuburg an der Donau finanzierte sie aus ihrer Privatschatulle, unter der ausdrücklichen Bedingung, ungenannt zu bleiben.
Das Christentum verstand sie offensichtlich nicht als Tünche bürgerlicher Wohlanständigkeit. Eine echte Tochter der Aufklärung war die Kurfürstinwitwe, fasziniert von der Toleranzidee, der Gleichheit aller vor dem Gesetz und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Der Französischen Revolution, die immerhin ihre Tante Marie Antoinette den Kopf gekostet hatte, gewann sie echte Werte ab. Noch in ihrem Todesjahr 1848 erklärte sie ungerührt, von ein paar revolutionären Änderungen gehe die Welt nicht unter.
Ihr letzter Liebhaber war Graf Sigmund von Berchem gewesen, fünfzehn Jahre jünger als sie und in seinen Gefühlen von einer biederen Freundlichkeit, nachdem die erste Leidenschaft vorüber war. Zeitweise schrieben sie sich dreimal täglich. Doch während die Grande Dame der Wittelsbacher seinen heruntergewirtschafteten Familienbesitz sanierte, seine Wäsche flickte und eifrig Socken für ihn strickte, vergrub sich der spröde Geliebte auf seinen Landgütern und mokierte sich am Ende gar öffentlich über ihre Anhänglichkeit.
Müde schrieb sie dem einst so zärtlichen Bettgenossen, sie könne eben nicht „halb lieben“. Gefühle nützten sich mit den Jahren keineswegs ab, denn der Geist könne frisch und jung bleiben, wenn der Körper auch altere. Ihr Herz habe „noch keine Rinde angesetzt, und obgleich ich ärgerlich und fast beschämt bin, muss ich gestehen, dass ich immer noch so liebe wie mit zwanzig Jahren.“
Zu guter Letzt heiratete der Graf (38) die hübsche, neunzehnjährige Tochter eines Staatsrats. Maria Leopoldine (54) fühlte sich überraschenderweise mehr befreit als verletzt und begegnete dem Paar fortan als mütterliche Freundin.
Am 23. Juni des Revolutionsjahres 1848 wollte sie sich mit der Kutsche auf ihr Gut Kaltenhausen bei Salzburg begeben. Als man einen steilen Berg bei Wasserburg hinauffuhr, kam der Kutsche ein Salzfuhrwerk, dessen Hemmschuhkette gebrochen war, in vollem Lauf entgegen. Beim Zusammenstoß verletzte sich die zweiundsiebzigjährige Kurfürstinwitwe schwer, zwei Rippen durchstachen die Lunge und führten zum Erstickungstod.
Im Volk lief alsbald eine andere Version um, die schön gruselig klang und auf jeden Fall besser zum abenteuerlichen Leben der alt gewordenen Dame passte: Maria Leopoldine habe in der unsicheren politischen Lage eine riesige Holzkassette mit Geld und Wertpapieren außer Landes bringen wollen. Bei dem Unglück sei die schwere, eisenbeschlagene Schatztruhe auf sie gefallen und habe ihr das Genick gebrochen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.