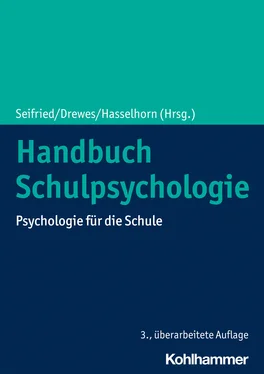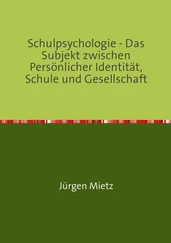Wissenschaftliche Forschungsergebnisse bilden die Handlungsgrundlage praktisch arbeitender Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Wie aber gelingt es, dass wissenschaftliche Forschungsergebnisse angemessen und erfolgreich in der Praxis genutzt werden? Hierfür müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. So muss entsprechend relevante Forschung vorliegen, die systematisch aufbereitet und hinreichend verständlich verfügbar gemacht worden ist. Auch müssen praktisch tätige Schulpsychologen und Schulpsychologinnen diese wissenschaftlichen Befunde kritisch reflektieren und hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und Nützlichkeit bewerten. Um das angemessen und erfolgreich zu leisten, bedarf es solider Kenntnisse forschungsmethodologischer Grundlagen ebenso wie der Befähigung zur kritischen Reflexion wissenschaftlicher Forschungsbefunde. Psychologische Forschung ist dann besonders nützlich, wenn sie zielgerichtet auf die Fragestellungen und Handlungsbedarfe der Schulpsychologie ausgerichtet ist, oder wenn sie schulpsychologische Beratungs- und Interventionsinstrumente evaluiert. Die Einrichtung schulpsychologischer Kompetenzzentren an den Universitäten in Tübingen und Frankfurt lassen vermuten, dass zukünftig vermehrt für die Schulpsychologie nützliche psychologische Forschung stattfindet.
Obwohl schon jetzt viele nützliche Theorien und Befunde in der wissenschaftlichen Psychologie vorliegen und die praktisch tätigen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen über hinreichende forschungsmethodologische Kenntnisse verfügen und zur kritischen Reflexion wissenschaftlicher Forschungsbefunde befähigt sind, stehen sie in der Praxis immer wieder neu vor der Herausforderung, dass die Probleme, zu deren Lösung sie beitragen sollen, oftmals diffus, widersprüchlich, komplex und zumindest uneindeutig sind. Die Folge ist, dass das alltägliche schulpsychologische Handeln immer wieder unter großer Unsicherheit erfolgt und subjektiv als Theorie-Praxis-Dilemma wahrgenommen wird. Diese Unsicherheit ist ein inhärenter Bestandteil des beruflichen Handlungsspektrums in der Schulpsychologie, da die schulpsychologische Expertise immer dann angefragt wird, wenn im Bereich des Erlebens und Verhaltens von Schülern und Schülerinnen oder aber in der Interaktion zwischen diesen und Lehrkräften Probleme auftreten, die sich nicht durch pädagogisch bewährte Maßnahmen haben lösen lassen und bei denen die beteiligten Schulverantwortlichen unter Handlungsdruck (oftmals auch unter Leidensdruck) stehen. Expertinnen und Experten der Schulpsychologie werden dann bei Krisen und Problemlagen einbezogen, wenn Standardlösungen nicht erfolgreich waren und bei den Verantwortlichen in der Schule große Unsicherheit herrscht.
Ein solcher Dauerzustand ist ein objektiver Belastungsfaktor für die Ausübung des Berufs einer Schulpsychologin bzw. eines Schulpsychologen, und damit ist das Risiko erhöht, sich permanent gestresst und überfordert zu fühlen. So verwundert es auch nicht, dass in verschiedenen Befragungen von praktisch tätigen Psychologinnen und Psychologen in den letzten Jahren auf das Theorie-Praxis-Dilemma hingewiesen und zum Ausdruck gebracht wurde, dass man weite Teile der Studieninhalte nicht für den beruflichen Alltag gebrauchen könne (z. B. Schneider & Roebers, 2000; Frensch, 2013; Hasselhorn, 2009). Oftmals führt das zu Debatten, ob überhaupt ein Vollstudium in Psychologie die bestmögliche Grundausbildung für eine eigenverantwortliche Tätigkeit in der Schulpsychologie sei. Wir sind der Überzeugung, dass eine solide psychologische Vollausbildung notwendige Voraussetzung ist, um die psychologische Expertise zu sichern, die maximal erfolgreiche Lösungen bei Problemen in der Schule und rund um das Thema Schule zu finden verspricht. Dazu wird ein wissenschaftliches Selbstverständnis schulpsychologischen Handelns skizziert, das seine Grundlage in den Theorien und Befunden der wissenschaftlichen Psychologie hat, die von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen durch ihr im Studium geschultes Vermögen zum hypothetisch-deduktiven Denken reflektiert und für die Suche und Entwicklung von Problemlösungen im schulpsychologischen Alltag genutzt werden (können). Allerdings sollte der breit qualifizierende Masterabschluss in Psychologie ergänzt werden durch spezielle Weiterbildungen, die gezielt auf das Arbeitsfeld der Schulpsychologie vorbereiten. 1 1 An den Universitäten Basel und Zürich gibt es solche Weiterbildungsgänge. Die Deutsche Psychologenakademie in Berlin bietet ein Curriculum Schulpsychologie an.
2.2 Grundlage: Theorien und Befunde der wissenschaftlichen Psychologie
Vor mehr als 100 Jahren hat der große Hamburger Psychologe William Stern den Terminus »Angewandte Psychologie« als Sammelbegriff für die praktische Anwendung psychologischer Erkenntnisse eingeführt ( 
Kap. I-1 1 Geschichte der Schulpsychologie in Deutschland Stefan Drewes und Anja Niebuhr 1.1 Einleitung 1.2 Geburtsstunde 1.3 Aufbau 1.4 Schulpsychologie in der ehemaligen DDR 1.5 Stagnation 1.6 Der Paradigmenwechsel und seine Auswirkungen 1.7 Konsolidierung 1.8 Vernetzung und Kooperationen 1.9 Ausblick Literatur
). Der gleiche William Stern war es auch, der im Rahmen eines Jugendkongresses 1911 die Einsetzung von Schulpsychologen forderte – eine Forderung, die in den Reihen der Schulverantwortlichen und der Lehrerschaft noch jahrelang auf heftigen Widerstand stieß. In der Forschung hat William Stern 1911 mit seinem Buch Differenzielle Psychologie die Teildisziplin der Differenziellen und Persönlichkeitspsychologie begründet. Lange Zeit kannte die Forschungsdisziplin Psychologie daraufhin nur den Unterschied zwischen einer Allgemeinen Psychologie und einer Differenziellen Psychologie. Während erstere sich mit der Beschreibung und der für alle Menschen geltenden Erklärung des Verhaltens und Erlebens beschäftigte, war letztere an der Beschreibung und Erklärung systematischer interindividueller Unterschiede zwischen Menschen interessiert. Heute ist das Spektrum der auch für die Schulpsychologie relevanten Teildisziplinen der Psychologie ungleich breiter. Neben der Allgemeinen Psychologie der Wahrnehmung, des Lernens, des Denkens, der Motivation, der Emotionen und des Handelns spielen gerade für das Handlungsfeld der Schulpsychologie auch die Entwicklungspsychologie und die Sozialpsychologie eine große Rolle. Hinzu kommt die anwendungsorientierte Subdisziplin der Diagnostik, die Instrumente zur Verfügung stellt, um die interindividuellen Unterschiede zwischen Menschen in ihrem Erleben und Verhalten objektiv, reliabel und valide erfassen zu können. Aber auch die Anwendungsdisziplinen der Klinischen Psychologie, der Arbeits- und Organisationspsychologie und insbesondere der Pädagogischen Psychologie haben viele Theorien, Konzepte und Ansätze erarbeitet, die zur Grundlegung schulpsychologischen Handelns gut geeignet sind.
In allen diesen Teildisziplinen werden Phänomene des menschlichen Erlebens und Verhaltens beschrieben und mit Hilfe von Theorien zu erklären versucht. Der wissenschaftliche Wert einer psychologischen Theorie bemisst sich daher über deren Erklärungswert. Dieser wiederum hängt ab von der Kohärenz und Eindeutigkeit der in der Theorie formulierten Zusammenhänge sowie vom Grad der empirischen Bewährung von Vorhersagen, die man aus der Theorie ableiten kann. Um Letzteres beurteilen zu können, ist eine gründliche methodische Ausbildung zu den Forschungsgrundlagen der Psychologie ( 
Kap. I-3 3 Forschungsgrundlagen der Schulpsychologie Christiane Loßnitzer, Tomasz Moschko, Caterina Gawrilow, Johanna Schmid und Marcus Hasselhorn 3.1 Einleitung 3.2 Angewandte Forschung im Kontext Schule 3.3 Conclusio Literatur
) erforderlich.
Читать дальше