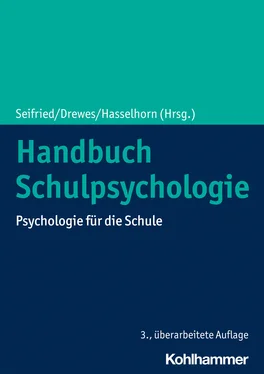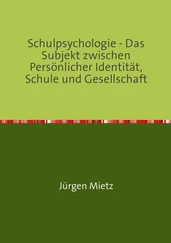Die keineswegs einheitlichen Organisationsformen, Schwerpunkte und konkreten Aufgabenbereiche der Schulpsychologischen Einrichtungen und Dienste haben sich aufgrund der häufig fehlenden gesetzlichen Grundlagen in den Bundesländern unterschiedlich entwickelt ( 
Kap. I-1 1 Geschichte der Schulpsychologie in Deutschland Stefan Drewes und Anja Niebuhr 1.1 Einleitung 1.2 Geburtsstunde 1.3 Aufbau 1.4 Schulpsychologie in der ehemaligen DDR 1.5 Stagnation 1.6 Der Paradigmenwechsel und seine Auswirkungen 1.7 Konsolidierung 1.8 Vernetzung und Kooperationen 1.9 Ausblick Literatur
). Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat zuletzt 1973 eine grundlegende Empfehlung zur Ausstattung Schulpsychologischer Beratungsstellen gegeben, neuere offizielle Empfehlungen existieren nicht.
Schulpsychologie wird grundsätzlich als Disziplin der angewandten Psychologie im Arbeitsfeld Schule verstanden. Trotz des Fehlens bundeseinheitlicher gesetzlicher Regelungen hat die Fachdisziplin selbst ein Selbstverständnis und eine allgemein gültige Aufgabenbeschreibung entwickelt, vor allem durch verschiedene Initiativen der Berufsverbände. Dennoch kommt es immer wieder zu Diskussionen, welche Aufgaben der Schulpsychologie zukommen und welche Organisationsform für die Schulpsychologie fachlich sinnvoll ist.
4.2 Begriffsbestimmung Schulpsychologie
In der wissenschaftlichen deutschsprachigen Literatur sind kaum Definitionen des Arbeitsfeldes Schulpsychologie zu finden. Die Sektion Schulpsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) definiert gemeinsam mit den Landesverbänden für Schulpsychologie in ihrem Berufsprofil »Schulpsychologie in Deutschland«: seit 2006 die gemeinsame Grundlage der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in Deutschland hinsichtlich Aufgaben, Arbeitsprinzipien und Qualifikationen von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. In der dritten Auflage heißt es (BDP Sektion Schulpsychologie, 2014a):
»Die Schulpsychologie ist der psychologische Fachdienst der Schule und unterstützt Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern, Lehrende, Schulleitungen, Schulaufsicht, Schulverwaltung und gesetzgebende Gremien.« (S. 3)
Ziel ist es,
»Schulen und Eltern in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu beraten und Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln sowie einen adäquaten Schulabschluss und eine altersgerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.« (ebd.)
In der Schweiz wurden 2014 neue Richtlinien für die Gestaltung der Schulpsychologie veröffentlicht (Interkantonale Vereinigung, 2014). Dort wird Schulpsychologie mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen definiert als
»eine international anerkannte Fachrichtung der Psychologie, welche sich mit Entwicklung, Lernen, Erziehung und Schule beschäftigt. Die schulpsychologische Arbeit dient der psychischen, intellektuellen und sozialen Entfaltung der Kinder und Jugendlichen sowie der Unterstützung der Schule in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag.« (Interkantonale Vereinigung, 2014, S. 1)
Diese offenen Definitionen lassen die Frage zu, ob die Schulpsychologie als eine eigene Fachdisziplin oder als »Psychologie im Anwendungsfeld Schule« zu verstehen ist. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Tätigkeit im Berufsfeld Schulpsychologie auf einer wissenschaftlichen Ausbildung mit einem Diplom- oder Masterabschluss in Psychologie bzw. in Bayern mit einem Staatsexamen in Schulpsychologie basiert.
4.3 Aufgaben und Arbeitsweisen
Drei Aufgabenbereiche prägen die schulpsychologischen Tätigkeiten in Deutschland und werden in unterschiedlicher Ausprägung umgesetzt:
1. Individuelle Beratung, oft auch schülerzentrierte Beratung genannt, die den einzelnen Schülerinnen und Schülern mithilfe schulpsychologischer Diagnostik, Beratung und Intervention in seiner Schullaufbahn und der schulischen Lern- und Lebenssituation unterstützt sowie Eltern und Lehrkräfte dazu berät
2. Systembezogene Angebote und Maßnahmen für Klassen, Lehrkräfte, Kollegien, Schulen und Institutionen, oft auch Systemberatung genannt, die z. B. Coaching und Supervision, Fortbildungen und Angebote zur Lehrergesundheit beinhalten sowie psychologische Prozessbegleitung bei der Implementation von schulorganisatorischen Maßnahmen oder pädagogischen Programmen
3. Mitarbeit in Projektgruppen und Gremien im Bildungsbereich, die Vernetzung und Kooperation mit anderen Berufsgruppen, die Umsetzung von schulpsychologischen Forschungsprojekten und die Evaluation von schulpsychologischen Maßnahmen
4.3.1 Individuelle oder schülerzentrierte Beratung
Die individuelle oder schülerzentrierte Beratung nimmt zunächst die Lernsituation, die Lernmöglichkeiten und das soziale Umfeld einzelner Schülerinnen und Schüler in den Blick. Ziel ist es, eine erfolgreiche Lernlaufbahn und eine angemessene Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Die Schule soll dadurch bei ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag unterstützt werden. Schulschwierigkeiten sollen frühzeitig erkannt und Interventionen eingeleitet werden.
Themen der schulpsychologischen Diagnostik, Beratung und Intervention können mit Bezug zum schulischen Lernen und Umfeld sein:
• Allgemeine Lernschwächen und Entwicklungsrückstände
• Lernmotivation und Lernverhalten
• Konzentration und Aufmerksamkeit
• Erhaltung oder Wiederherstellung der psychischen und physischen Gesundheit
• Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechnens, insbesondere bei Lese- und Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche
• Besondere Begabungen bis hin zur Hochbegabung
• Soziale Integration und Sozialverhalten
• Allgemeine Ängste, Leistungsängste
• Schuldistanz und Schulvermeidung
• Psychische Krisen und Erkrankungen
• Schwierige psychosoziale Lebenssituationen der Familie, familiäre Belastungen und Krisen, Kinderschutz
• Wahl einer Schulform und Schullaufbahn
• Klassen-, Schulwechsel und Schulübergang
• Förderplanung bei sonderpädagogischem Förderbedarf
4.3.2 Schulbezogene Beratung und Systemberatung
Die schulbezogene Beratung und Systemberatung der Schulpsychologie richtet ihre Angebote auf die Unterstützung von Lehrkräften in ihrem beruflichen Handeln sowie auf Schulen zur Unterstützung von Organisations- und Teamentwicklungsprozessen. Dies beinhaltet Angebote zu Fragen der persönlichen Arbeits- und Belastungssituation von Lehrkräften, Angebote zur Supervision, zum Coaching oder zur Teamentwicklung von Teilkollegien oder ganzer Kollegien sowie Fortbildungen für Lehrkräfte zu schulpsychologischen Themen.
Themen können beispielsweise sein:
• Beziehungsaufbau und -gestaltung zu Schülerinnen und Schülern
• Umsetzung von Maßnahmen der individuellen Förderung und Inklusion
• Umgang mit eigenen oder von außen herangetragenen Leistungserwartungen
• Bewältigung von Konfliktsituationen und Kommunikationsproblemen
• Beratungs- und Erziehungsbedarf in der Schülerschaft
• Bewältigung von schwierigen Unterrichtssituationen
• Klassenregeln und Klassenführung
• Prävention und Bewältigung von Krisenereignissen in der Schule
• Berufszufriedenheit und Work-Life-Balance
• Stressbewältigung, Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit
• Führungsaufgaben der Schulleitung
• Folgen von schulorganisatorischen Maßnahmen wie Schulauflösungen oder -fusionen
• Beratung von Schulen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil von Familien mit psychosozialen Belastungen
Читать дальше