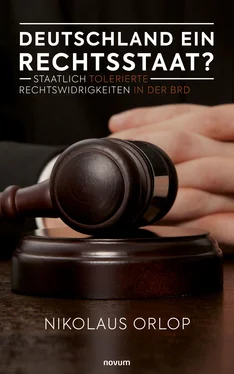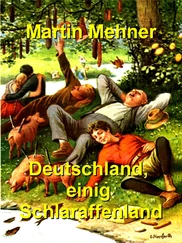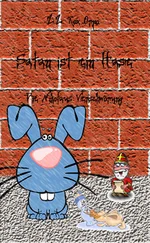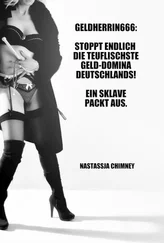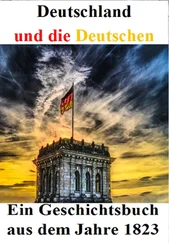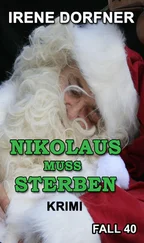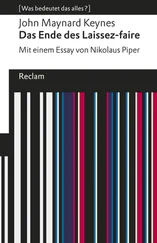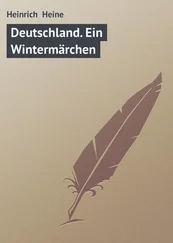Ohne das Einschalten der Bundesanstalt für Arbeit wäre es zu zwei großen Fehlurteilen, einmal beim Strafgericht, einmal beim Sozialgericht, mit erheblichen Nachteilen für das Bauunternehmen gekommen. Das Arbeitsamt wusste oder hätte wissen müssen, dass bei diesem geschilderten Sachverhalt niemals ein Betrug vorliegen konnte. Die Strafkammer mit drei Berufsrichtern hätte ebenso wie die Staatsanwaltschaft ihre falsche rechtliche Auffassung erkennen oder sich zumindest durch Fachkompetenz informieren können. Und das Sozialgericht, das im Wesentlichen ständig mit diesen Fällen zu tun hat, hätte sich ebenfalls nicht auf Unkenntnis berufen können.
Wie kann eine derartige Unkenntnis in zwei unabhängigen Gerichten überhaupt möglich sein? Man kann nicht soweit gehen, zu behaupten, die deutsche Justiz sei nur noch mit unwissenden Richtern besetzt. Wäre das Landesarbeitsamt Nordbayern nicht eingeschritten, hätte die große Strafkammer eine hohe Freiheitsstrafe ausgesprochen und das mittelständische Unternehmen wäre womöglich ruiniert gewesen.
Richterliche Verstöße im Arbeitsrecht
Das Arbeitsgerichtsverfahren ist ein gesonderter Gerichtszweig des Zivilverfahrens und regelt die Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, wobei das Ziel dieser Gerichte ist, ein streitiges Arbeitsverhältnis nicht durch ein Gerichtsverfahren zusätzlich zu belasten. Aus diesem Grunde ist ein zwischen den Parteien geschlossener Vergleich nicht nur vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht, sondern auch eine durchaus erstrebenswerte Beendigungsmöglichkeit in diesem Gerichtsverfahren. Oberster Grundsatz des Arbeitsgerichtsverfahrens sollte und müsste allerdings sein, dass es sich dabei um ein objektives Gerichtsverfahren handelt, bei dem der Richter ausschließlich nach den gesetzlichen Vorschriften den Sachverhalt abschließend beurteilt und nicht eine der beiden streitenden Parteien bevorzugt.
1. Richter als Sozialpolitiker
Es gibt zwar immer wieder Anwälte, vor allem solche, die in der Regel ausschließlich Arbeitnehmer vor den Arbeitsgerichten vertreten und behaupten, der Arbeitgeber habe vor diesem Gerichtszweig keinerlei Chancen. Das ist zwar grober Unsinn, weil im Allgemeinen ein objektiver Vorsitzender Richter den Arbeitnehmer, der vielleicht eine Bevorzugung erhofft, von vornherein darauf hinweist, dass es sich hierbei um ein objektives Gerichtsverfahren handelt. Ein korrekter Richter würde darauf hinweisen, dass ausschließlich die Sach- und Rechtslage den Ausgang des Verfahrens bestimmen. Dennoch sind häufig Richter oder Richterinnen anzutreffen, die dazu neigen, den Standpunkt des Arbeitnehmers etwas positiver und auch wohlwollender zu sehen.
In diesem Sinne äußerte sich auch ein Richter am Arbeitsgericht Hamburg ganz offen und unmissverständlich. Er erklärte nämlich vor laufender Kamera ungeniert, ihm gehe es bei der Arbeitsgerichtsverhandlung nicht um Rechtsprechung. Er wolle vielmehr in der von ihm geleiteten Gerichtsverhandlung ausschließlich Sozialpolitik für die Schwächeren in unserer Gesellschaft betreiben.
Was mit diesem Arbeitsrichter in der Justiz in Hamburg geschah, ist nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass ein derartiger Vorsitzender Richter nicht nur gegen den absoluten Grundsatz der Objektivität in der Justiz verstößt. Für ihn war auch der verfassungsrechtliche Grundsatz der Gewaltenteilung ganz offensichtlich ein Fremdwort.
2. Richter nötigt zum Vergleichsabschluss
In ähnlicher Weise verhielt sich ein Richter am Arbeitsgericht München, der dafür bekannt war, dass er mit der Verfahrensordnung und wohl auch dem materiellen Arbeitsrecht offensichtlich Schwierigkeiten hatte. Wenn bei einem arbeitsgerichtlichen Termin die Parteien im Sitzungssaal erschienen, begann er sofort mit dem Satz: „Ich mache nur Vergleiche“. Sollte sich dann aus verständlichen Gründen einer der Parteienvertreter, in der Regel der Arbeitgebervertreter, weigern, ging der Richter soweit, die Parteien ins Beratungszimmer zu nötigen, um hier, ohne Anwesenheit der notwendigen Öffentlichkeit, über eine vergleichsweise Beendigung des Rechtsstreits zu verhandeln und die Parteien förmlich zu einem Vergleichsabschluss zu zwingen.
Dieser Richter hatte, einmal unterstellt, dass ihm die Verfahrensordnung zumindest in den Grundzügen bekannt war, die Regelungen des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG), einen diesbezüglichen Sachverhalt zu erforschen, gründlich missverstanden. Dieses Gesetz befasst sich, wie schon der Name sagt, mit dem allgemeinen Schutz des Arbeitnehmers, wenn der Arbeitgeber durch Kündigung das Arbeitsverhältnis beenden möchte.
Nach § 9 KSchG kann der Richter, wenn dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses trotz Unwirksamkeit der Kündigung nicht mehr zuzumuten ist, das Arbeitsverhältnis auf Antrag auflösen. Gleichzeitig spricht das Gericht dem Arbeitnehmer eine angemessene Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes zu. Viele Arbeitsrichter vermitteln allerdings den Eindruck, wegen des laufenden Rechtsstreits zwischen den Parteien sei die Fortsetzung des Vertragsverhältnis dem Arbeitnehmer in der Regel sowieso nicht mehr zuzumuten. Sie arbeiten deshalb häufig auf eine Beendigung mit einer Abfindung hin. Dies hat einerseits für den Richter den immensen Vorteil, in einer Verhandlung den Rechtsstreit insgesamt zu beenden, andererseits muss das Gericht keine Entscheidung mehr treffen, die durch ein Berufungsurteil des Landesarbeitsgerichtes wieder aufgehoben werden könnte. Und die Anwälte werden vom Gesetzgeber zusätzlich belohnt, indem sie bei Vergleichsabschluss neben den normalen Gebühren eine zusätzliche Vergleichsgebühr erhalten.
In dieser Weise wird, manches Mal fast in Form einer Nötigung, die eine Partei, meistens der Arbeitgeber, zum Abschluss eines Vergleiches gezwungen, obwohl sie eigentlich die berechtigte Auffassung vertritt, z. B. eine Kündigung ordnungsgemäß wirksam und völlig zu Recht ausgesprochen zu haben.
Diese Art eines Gerichtsverfahrens hat mit der Rechtsstaatlichkeit der Justiz nichts mehr gemein. Hier wird eine Partei gezwungen oder richtiger gesagt, genötigt, sich zu etwas zu entscheiden, das sie berechtigterweise nicht wollte. Weigert sich der Arbeitgeber dennoch, einem Vergleichsabschluss zuzustimmen, riskiert er in aller Regel, ein unterliegendes Urteil hinzunehmen. Damit wird entweder das Arbeitsverhältnis fortgesetzt oder die Berechtigung der Kündigung muss erst in einem langwierigen Verfahren, unter Umständen in drei Instanzen bis zum Bundesarbeitsgericht, mit enormen finanziellen Kosten durchgeführt werden.
3. Richter bevorzugt bewusst eine Partei
In einem Fall waren die Parteien zwar mit dem Abschluss des Vergleichs und der Höhe der Abfindung einverstanden. Dennoch wollte der Vorsitzende Richter aus unerfindlichen Gründen dem Arbeitnehmer zu einer höheren Vergleichssumme verhelfen.
Der Arbeitgeber hatte einem Baupolier mit einem Monatsgehalt von ca. 4.000 DM aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen gekündigt. Dabei war ihm aber der Fehler unterlaufen, dass die schriftliche Kündigung dem Arbeitnehmer erst nach Ablauf der sechs Monate zugegangen war. § 1 KSchG, der die soziale Rechtfertigung einer Arbeitgeberkündigung darstellt, ist praktisch ein gesetzliches, frei kündbares Probearbeitsverhältnis. Hier kann der Arbeitgeber, abgesehen von einer Sittenwidrigkeit, das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer noch frei kündigen.
Durch den Ablauf dieser Sechs-Monat-Frist hatte dieser Polier den gesetzlichen Kündigungsschutz jedoch erworben, so dass ihm nur noch gekündigt werden konnte, wenn ein bestimmter berechtigter Grund vorlag. Er erhob somit zulässigerweise Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht, hatte aber bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden, bei dem er sich offensichtlich wohler als bei dem früheren fühlte. Die Klage hatte somit lediglich den Sinn, von dem früheren Arbeitgeber zulässigerweise wenigstens eine Abfindung für den Verlust des alten Arbeitsverhältnisses zu erhalten. Vor dem Gerichtstermin trafen sich der Kläger und der Anwalt des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer erklärte, mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und mit der vom Arbeitgeber angebotenen Abfindung in Höhe von 1.000 DM einverstanden zu sein.
Читать дальше