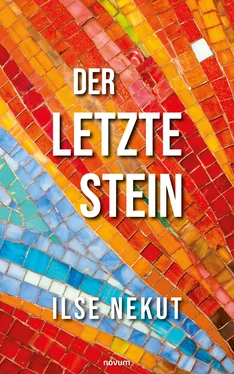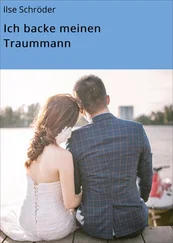„Das verstehst du nicht.“
Es musste etwas Bedrohliches, Gefährliches sein, das las Dora in den Mienen der Erwachsenen.
Mit ihrer Schwester fühlte sie sich sicher, Dora war ja erst acht.
An einem Sonntag im Mai saß Dora auf Papas Schultern und überragte die dichte brodelnde Menschenmenge auf dem Wiener Rathausplatz. Viele schwenkten kleine Fähnchen in der Hand. Rot – Weiß – Rot. Dora hatte eine recht gute Aussicht da oben auf Papas Schultern, und sie fühlte sich wohl, trotz der Menschenmenge.
„Vorne ist das Rathaus“, erklärte Vati ihr.
Es war Mai 1955, und die Menschen feierten ‚Staatsvertrag‘, was immer das war. Sie verstand es nicht. ‚Wieder so ein Wort …‘, dachte Dora. Dass auch die Russen jetzt abzogen, hatte sie irgendwo aufgeschnappt.
Sie verstand nicht, warum die Russen jetzt Wien verließen, sie waren doch immer nett zu ihr und ihrer Schwester gewesen. ‚Warum also?‘ Aber die Menschen neben und unter ihr schienen den Tag zu genießen. Viele weinten, Dora hätte sie gerne getröstet, bis sie begriff, dass es Freudentränen waren.
Später, vor dem Einschlafen im Bett, musste Dora an Maria denken. Maria war wie sie selbst acht Jahre alt und wohnte in einem der Nachbarhäuser. Ihr Gesicht war fürchterlich entstellt, denn ihre Mutter hatte versucht, den Fötus mit einer Stricknadel abzutreiben. Ein Russenkind, entstanden aus einer Vergewaltigung, lebte jetzt mit entstelltem Gesicht in einem der Nachbarhäuser. ‚Ich verstehe so vieles noch nicht‘, dachte Dora. ‚Vergewaltigung‘, ‚Fötus‘, ‚abtreiben‘ – alles Worte, mit denen sie nichts anzufangen wusste. Also dachte sie lieber an die vielen Glücklichen auf dem Rathausplatz und an die Musiker, die den Donauwalzer spielten. Mit Musik kannte Dora sich schon ein wenig aus, aber mit anderen Dingen …? Sie konnte schon Sonatinen von Haydn spielen, aber ‚abtreiben‘, das konnte sie nicht.
Als sie an diesem Freudentag eingeschlafen war, träumte sie von einem Mann in grauer Uniform, in der einen Hand eine Stricknadel, in der anderen ein Fähnchen mit den rot-weiß-roten Farbstreifen, wie sie sie am Rathausplatz gesehen hatte. Der Uniformmann lächelte Dora in ihrem Traum ruhig zu, aber von seiner Stricknadel tropfte Blut. Und er hatte hinter seinem Lächeln schwarze Zähne.
Dora schrie in dieser Nacht. Mama kam zu ihr, um sie zu beruhigen. „So ein schöner Tag“, sagte sie, „… und du schreist. Lach doch lieber, Kind, lach doch!“
Der 15. Mai 1955 war vorbei. ‚Gut so‘, dachte Dora.
Der verpatzte Bub
Dora war acht,
als sie eigentlich ein Bub war.
Da sie draufgängerisch und wagemutig handelte, erklärte Mama immer wieder jedem, mit dem sie über Dora redete:
„Sie ist ein verpatzter Bub.“
In ihrer Stimme war so etwas wie leiser Stolz zu hören.
Ein Mädchen war also ein verpatzter Bub. Dora dachte nach.
‚Wieso ist nicht ein Bub ein verpatztes Mädchen?‘
Sie wusste es nicht und streunte weiter mit ihren Freundinnen durch den dicht bewaldeten Stadtrand. Natürlich waren ihre Streifzüge örtlich begrenzt, sie waren ja erst acht, aber ein Ausflug zur versteckten Wiese – so nannten sie den großen Grasflecken oberhalb des kleinen Berges in Omas riesigem Garten – kam ihr und ihren Freundinnen vor wie eine weite, gefährliche Reise.
Wenn die Mädchen zu weit hinauf in den Wald gegangen waren und Mutter das erfuhr, sagte sie streng:
„Wenn ihr so weiter macht, wird euch einmal der schwarze Mann holen.“
‚Schwarzer Mann? Rauchfangkehrer? Neger? Dora wusste es nicht und durchstreifte weiter Wiesen und Wälder.
Um ihrem Ruf als Bub, ob verpatzt oder nicht, gerecht zu werden, kletterte sie auf jeden halbwegs mit Ästen bestückten Baum und rannte mit den Buben um die Wette. Dass sie dabei einmal stürzte und sich ihre Knie zerschürfte, störte sie nicht.
Als sie schon in die dritte Klasse, die 3b, ging, rutschte sie im Winter auf ihrer ledernen Schultasche einen steilen, vom Eis glatten Hang hinunter. Auf diese Weise zeigte sie den mitrutschenden Buben etliche Male, dass sie zu ihnen gehörte. Ein wahrer Bub unter verpatzten Mädchen, das war sie.
Peter, ein Bub aus ihrer Klasse, wartete jeden Morgen bei der Kreuzung auf Dora. Sie gingen dann gemeinsam zur Schule. Peter wurde von seinen Schulkollegen gehänselt, weil er mit einem Mädchen ging.
„Du mit einem Mädel! Waschlappen!“, riefen sie.
Dora merkte, dass es besser war, ein Bub zu sein. Und es war wohl auch besser, später ein Mann zu werden statt ein Fräulein.
Auch einen Unfall mit ihrem Rad nahm Dora tapfer in Kauf. Sie wurde anerkannt von den etwas fremden Wesen, die noch Kinder waren, aber einmal Männer werden sollten.
Alles hatte seine Richtigkeit, nur ihre Mutter sah dem Treiben besorgt zu. Ihr wäre lieber gewesen, Dora hätte sich mit einem hübschen Kleidchen ins Kinderzimmer begeben und hätte dort mit Puppen gespielt.
Dass ihre Tochter ‚auf Bub komm raus‘ am liebsten abgewetzte Hosen trug und sich beim Friseur die Haare kurz schneiden ließ, irritierte sie, aber sie ließ sich nichts anmerken.
‚Es wird vorüber gehen‘, tröstete sie sich selbst.
Und irgendwie war da auch Stolz dabei.
Das Blut
Dora war neun,
als das mit Lisa passierte.
Lisa war nicht nur Kusine, auch Freundin. Und sie riss sich beim Hinfallen auf der großen Wiese, auf der sie beide ohne Aufsicht spielten, den Oberschenkel an einem Stacheldraht auf. Sehr tief.‚Warum ist Blut rot und nicht blau oder grün?‘, dachte Dora.
‚Warum ist die Wunde ihrer Kusine so groß und so tief?
Warum sieht man in dieser Wunde weißes Muskelfleisch, das wie Grießpudding aussieht?
Und warum sang die Frau in dem alten Haus neben der Wiese, auf der sie spielten, immer wieder zuerst Opernarien und als Abschluss ‚Deutschland, Deutschland über alles‘? Bei offenem Fenster.
Obwohl doch Deutschland früher sehr böse war. Das sagte Mama.
Und warum waren die Augen von diesem Herrn Hitler, den Oma manchmal zornig erwähnte, braun und nicht rosa?‘
Wo man singt, da lass dich nicht gleich nieder,
auch böse Menschen haben ihre Lieder.
Das hatte Oma sie gelehrt. ‚Vielleicht hatten die bösen Deutschen früher böse Lieder, und die Sängerin in dem alten Haus neben der Wiese konnte das nicht vergessen … Sie sang schön, wie ein Engel.‘
Lisas Blut.
Doras Kusine Lisa saß mit gepunktetem Rock, aber grießpuddingähnlichem blutigem Muskelfleisch auf einem Baumstamm und war bleich im Gesicht. Das rote Blut – nicht blau, nicht grün, nein, rot war es – schoss plötzlich wie aus einem leicht verstopften Springbrunnen aus ihrem Oberschenkel.
Doras Augen starrten auf die Verletzung.
‚Warum sind Augen niemals rosa oder lila?‘
Lisas Blut.
Dora rannte zu dem alten Haus mit der Sängerin, um Hilfe zu holen. Sie rannte nicht nach Hause, nein. Sie hetzte zur Sängerin. Wie ein Blitz die Stufen hinauf, und schon war sie im Sängerinnenzimmer. Die Frau, die oft Opernarien und danach das Deutschlandlied sang, rief die Rettung an. Gott sei Dank hatte sie Telefon, Doras Eltern hatten keines. ‚Warum nicht?‘
Dora dachte an ihren Papa, der selbst keine Opernarien sang, sondern solchen Gesängen nur lauschte. Mit Kopfhörern und geschlossenen Augen. Ansprechbar war er nicht, wenn er dies tat, und Dora hasste diesen Rückzug ihres Vaters in die Arienwelt.
Gut, dass die Kusine jetzt in guten Händen war. Dora schaute zu den Wolken hinauf, die heute weiß waren. ‚Warum sind Wolken weiß oder grau und nicht kariert?‘
Und sie sah, wie aus den Wolken über ihr eine grießbreiähnliche Masse floss und einen blutroten Regen ankündigte.
‚Warum ist Blut rot?‘, fragte sie sich wieder und wieder.
Die Panzer
Читать дальше