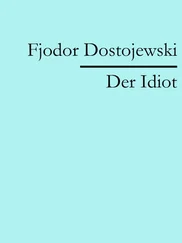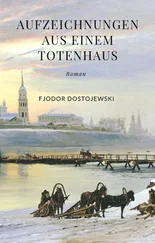Meine Hoffnungen erfüllten sich nicht ganz: ich traf sie nicht allein; Wersilow war freilich nicht da, aber bei meiner Mutter saß Tatjana Pawlowna – immerhin ein fremder Mensch. Die Hälfte meiner edelmütigen Stimmung verflog mit einem Ruck. Merkwürdig, wie schnell es bei mir in solchen Fällen geht und wie wetterwendisch ich bin; ein Sandkorn oder ein Haar genügt, und das Gute ist fort, und das Böse ist an seine Stelle getreten. Meine schlechten Eindrücke weichen, zu meinem Bedauern, nicht so schnell, obschon ich durchaus nicht nachtragend bin. Als ich eintrat, hatte ich den blitzartigen Eindruck, daß meine Mutter im selben Moment ihre Unterhaltung mit Tatjana Pawlowna, die augenscheinlich recht lebhaft gewesen war, abgebrochen hatte. Meine Schwester war erst eine Minute vor mir von ihrer Arbeit heimgekommen und war noch in ihrem Kämmerchen.
Unsere Wohnung bestand aus drei Zimmern. Das Zimmer, in dem wir gewöhnlich alle saßen, das Wohnzimmer, lag in der Mitte und war ziemlich groß und sah beinahe anständig aus. Es befanden sich darin immerhin ein paar weiche rote Diwans, die übrigens sehr verschlissen aussahen (Wersilow duldete keine Überzüge), einige Teppiche, ein paar Tische und überflüssige Tischchen. Dann lag zur Rechten Wersilows Zimmer, ein enges, schmales, einfenstriges Gelaß; darin stand ein elender Schreibtisch, auf dem sich einige unbenutzte Bücher und in Vergessenheit geratene Schriftstücke herumtrieben, und vor dem Tisch ein nicht minder elender Polstersessel, an dem eine Feder zerbrochen war, die in einem spitzen Winkel herausstand, und über die Wersilow oftmals ächzte und schimpfte. In demselben Kabinett wurde ihm auch auf einem weichen und ebenfalls abgenützten Diwan sein Nachtlager hergerichtet; er haßte sein Kabinett und tat, glaube ich, nichts darin, sondern zog es vor, ganze Stunden lang müßig im Wohnzimmer zu sitzen. Linker Hand von dem Wohnzimmer lag wieder ein Zimmer: dort schliefen meine Mutter und meine Schwester. Das Wohnzimmer betrat man von einem Korridor aus, an dessen Ende eine Tür in die Küche führte; dort hauste die Köchin Lukeria, und wenn sie kochte, erfüllte sie die ganze Wohnung unbarmherzig mit einem Qualm von verbranntem Fett. Es gab Minuten, wo Wersilow sein Leben und sein Schicksal mit lauter Stimme verfluchte, und in dieser einen Beziehung fühlte ich durchaus mit ihm; ich hasse diese Gerüche gleichfalls, obwohl sie zu mir gar nicht hinaufdrangen, denn ich wohnte oben unter dem Dache, in einem Stübchen, zu dem ich auf einer riesig steilen, schmalen, knarrenden Treppe hinaufstieg. Zu erwähnen war da nur ein halbrundes Fenster, die schrecklich niedrige Decke, ein mit Wachstuch überzogener Diwan, auf den mir Lukeria für die Nacht ein Laken breitete und ein Kissen legte, an sonstigen Möbeln waren nur noch zwei Stück da: ein höchst primitiver Tisch aus rohen Brettern und ein durchgesessener Rohrstuhl.
Übrigens hatten wir trotz alledem noch einige Überbleibsel ehemaligen Komforts; so stand zum Beispiel im Wohnzimmer eine sehr hübsche Porzellanlampe, an der Wand hing ein vorzüglicher Stich nach der Dresdener Madonna, und ihr gegenüber, an der anderen Wand, eine teure Photographie der Bronzetüren des Doms von Florenz in riesigem Format. In demselben Zimmer hing in der Ecke ein großer Heiligenschrein mit alten Familienheiligenbildern, unter denen eins (das Bild »Allerheiligen«) eine große silbervergoldete Einfassung hatte – es war das, das sie versetzen wollten – und ein anderes (das Bild der Mutter Gottes) zeigte eine Samteinfassung mit Perlen bestickt. Vor den Heiligenbildern hing ein Lämpchen, das an jedem Feiertag angezündet wurde. Wersilow waren die Heiligenbilder, bezüglich ihrer inneren Bedeutung, offenbar sehr gleichgültig, nur manchmal kniff er die Augen, sichtlich an sich haltend, vor dem Lichte des Lämpchens zusammen, das von der vergoldeten Einfassung reflektiert wurde und klagte leichthin darüber, daß das schlecht für seine Augen wäre, verwehrte es aber meiner Mutter dennoch nicht, es anzuzünden.
Ich trat für gewöhnlich schweigend und verdrossen ein, wenn ich nach Hause kam, schaute in eine Ecke und grüßte manchmal beim Eintreten überhaupt nicht. Ich war sonst immer früher heimgekommen als heute, und das Mittagessen wurde mir dann nach oben gebracht. Als ich heute eintrat, sagte ich auf einmal: »Guten Abend, Mama«, was ich früher niemals getan hatte; aber dennoch konnte ich mich aus Verlegenheit auch heute nicht überwinden, sie dabei anzusehen, und setzte mich auf einen Stuhl am entgegengesetzten Ende des Zimmers. Ich war sehr ermüdet, aber daran dachte ich nicht.
»Kommt dieser Flegel noch immer so lümmelhaft zu Ihnen herein wie früher?« zeterte Tatjana Pawlowna gegen mich los; Schimpfworte hatte sie sich auch früher schon erlaubt: das war zwischen ihr und mir gewissermaßen zur Gewohnheit geworden.
»Guten Abend«, antwortete meine Mutter in einem Tone, als wäre sie ganz fassungslos darüber, daß ich sie begrüßt hatte.
»Das Essen ist längst fertig,« fuhr sie fort und war ganz verwirrt, »die Suppe wird wohl kalt geworden sein, aber ich will gleich die Koteletts . . .« Sie wollte hastig aufstehen und in die Küche gehen, und vielleicht zum erstenmal in diesem ganzen Monat überkam es mich plötzlich wie Scham, daß sie gar so hurtig aufsprang, um mich zu bedienen; bis dahin hatte ich das doch selbst von ihr verlangt.
»Danke schön, Mama, ich hab' schon gegessen. Wenn ich nicht störe, möchte ich mich hier ein bißchen verschnaufen.«
»Oh . . . Natürlich! . . . Warum denn nicht . . .? Bleiben Sie nur sitzen . . .«
»Machen Sie sich keine Sorgen, Mama, ich werde keinen Krakeel mehr mit Andrej Petrowitsch anfangen«, fiel ich ihr plötzlich ins Wort . . .
»Ach, du lieber Herrgott, wie edel von ihm!« schrie Tatjana Pawlowna. »Aber liebste Sonja – sagst du denn wirklich noch immer Sie zu ihm? Was ist er denn für ein großer Herr, daß man ihm solche Ehrungen erweisen muß, und noch dazu seine leibliche Mutter! Es ist doch lächerlich, du bist ja ganz verlegen vor lauter Respekt vor ihm; das ist ja ein Spott und eine Schande!«
»Mama, es wäre mir selbst sehr angenehm, wenn Sie mich duzen wollten.«
»Oh . . . Ja, schön, ja, das will ich auch,« verhaspelte sich meine Mutter: »ich – ich hab' es ja vorher nicht . . . aber jetzt werde ich es mir schon merken.«
Sie war über und über rot geworden. Ihr Gesicht hatte entschieden etwas außergewöhnlich Anziehendes . . . Ihr Gesicht hatte einen treuherzig-naiven, aber durchaus nicht einfältigen Ausdruck, es war etwas blaß und blutleer. Ihre Wangen waren sehr mager, sogar eingefallen, und über ihre Stirne begannen sich schon zahlreiche Runzeln zu ziehen, aber um die Augen hatte sie noch keine, und die ziemlich großen Augen leuchteten immer in einem stillen, ruhigen Licht, das mich vom ersten Tage an zu ihr hingezogen hatte. Ich hatte es auch gern, daß in ihrem Gesicht nichts Betrübtes und Gedrücktes lag; ganz im Gegenteil, ihr Ausdruck wäre sogar heiter gewesen, wenn sie sich nicht so oft aufgeregt hätte, manchmal ohne jede Veranlassung; sie erschrak oft und fuhr wegen nichts und wieder nichts von ihrem Sitz auf, oder sie horchte ängstlich, wenn ein neues Gesprächsthema aufgenommen wurde, bis sie sich überzeugt hatte, daß alles gut blieb wie zuvor. Es ist alles gut – hieß bei ihr eben, daß alles »beim Alten« blieb. Wenn nur keine Veränderung eintrat, wenn nur nichts Neues geschah, und mochte es auch ein glückliches Ereignis sein! . . . Man hätte denken können, sie wäre als Kind einmal eingeschreckt worden. Außer ihren Augen gefiel mir auch noch das Oval ihres länglichen Gesichtes, und ich glaube, wenn ihre Backenknochen nur um eine Idee schmäler gewesen wären, hätte man sie, nicht etwa nur in ihrer Jugend, sondern auch heute noch hübsch finden können. Sie war jetzt erst neununddreißig, aber in ihren dunkelblonden Haaren schimmerten schon viele weiße Fäden.
Читать дальше