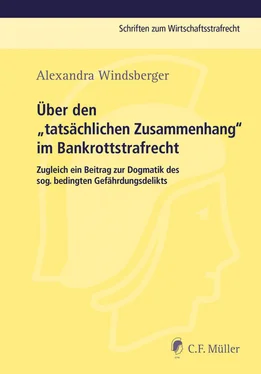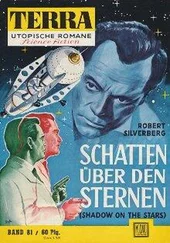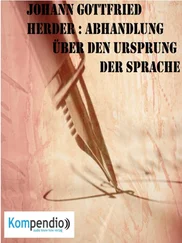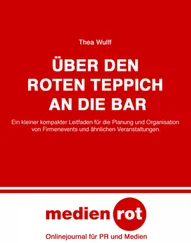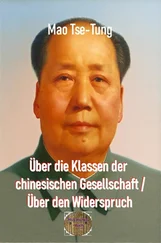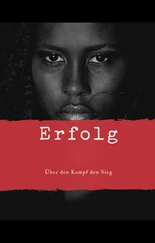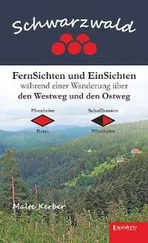b) Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „schuldindifferenter Kausalzusammenhang“
c) Der „tatsächliche Zusammenhang“ in Gestalt des „Gegenbeweises der Ungefährlichkeit“
d) Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „außerordentliches Zurechnungskriterium“
e) Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „ungeschriebene Einschränkung“ des § 283 Abs. 6 StGB
2. Notwendigkeit eines Zusammenhangs zwischen Krise und Bedingung: Der krisenspezifische „Unmittelbarkeitszusammenhang“
3. Die Gegenauffassung: Kein Bedürfnis für ein übergesetzliches Korrektiv in Form eines Zusammenhangs
V. Stellungnahme: Notwendigkeit einer übergesetzlichen Korrektur?
Teil 2 Materiellrechtliche Erforderlichkeit eines „tatsächlichen Zusammenhangs“ als übergesetzliches Korrektiv?
A. Korrekturbedürfnis im Rahmen der §§ 283 ff. StGB?
I. Der „tatsächliche Zusammenhang“ als Symptom eines korrekturbedürftigen Delikts
1. Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Kontext sog. „Risikogeschäfte“ mit „positivem Ausgang“
2. Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Kontext der sog. „Krisenüberwindung“
3. Der „tatsächliche Zusammenhang“ zur Vermeidung eines „ewigen Delikts“
II. Das „bedingte Gefährdungsdelikt“ als Ursache?
B. Das „bedingte Gefährdungsdelikt“ als Bezugsgegenstand
I. Zur Rechtsnatur des bedingten Gefährdungsdelikts
II. Sonstige „bedingte“ Delikte des besonderen Teils
1. Der Tatbestand des § 231 StGB
2. Der Tatbestand des § 323a StGB
3. Der Tatbestand des § 186 StGB
4. Der Tatbestand des § 113 StGB
5. Der Tatbestand des § 104a StGB
6. Der Tatbestand des § 130 OWiG
7. Zwischenergebnis: Allgemeines Korrekturbedürfnis des „bedingten Gefährdungsdelikts“
C. Allgemeines Anforderungsprofil an das „bedingte Gefährdungsdelikt“
I. Die Minimalanforderungen an das Schuldprinzip
1. Das Kongruenzgebot
2. Interdependenz von Kongruenzgebot und Abzugsthese
3. Das gleichzeitige Erfordernis eines „hinreichenden“ Tatbezugs
4. Die Paradoxie der objektiven Bedingung der Strafbarkeit
II. Schlussfolgerung: Zwei Interpretationsmöglichkeiten des bedingten Gefährdungsdelikts
1. Das bedingte Gefährdungsdelikt im Kontext der Verbindungsthese
2. Das bedingte Gefährdungsdelikt im Kontext der Trennungsthese
3. Konsequenz für das Bankrottstrafrecht
Teil 3 Anwendung auf das Bankrottstrafrecht
A. Interpretationsvorschlag des § 283 Abs. 1 StGB nach der Verbindungsthese
I. Ausgangspunkt: § 283 Abs. 6 StGB als „Erfolgskomponente“
II. Konsequenz: Erfordernis einer Deckungsbeziehung
1. Verknüpfung über einen Kausalzusammenhang?
a) Maßstab der Verursachung eines Erfolges
b) Formulierung eines Kausalgesetzes im Sinne des § 283 Abs. 1 StGB
2. Verknüpfung über einen Schuldzusammenhang?
3. Verknüpfung über einen tatsächlichen Zusammenhang?
III. Ablehnung der Verbindungsthese
B. Interpretationsvorschlag des § 283 Abs. 1 StGB nach der Trennungsthese
I. Dogmatische Vorüberlegungen zum Strafgrund abstrakter Gefährdungsdelikte
1. Abstraktionsüberschuss abstrakter Gefährdungsdelikte?
2. Strafgrund der abstrakt gefährlichen Handlung?
a) Legitimation abstrakter Gefährdungsdelikte nach der Präsumtionstheorie
b) Legitimation abstrakter Gefährdungsdelikte auf Grund der „generellen Gefährlichkeit“ bestimmter Tätigkeiten
3. Strafgrund des „ungefährlichen Einzelfalls“?
a) Zulassung des Gegenbeweises der Ungefährlichkeit
b) Teleologische Reduktion bei erwiesener Ungefährlichkeit der Handlung?
II. Stellungnahme: Das hier vertretene Konzept zur Begründung abstrakter Gefährdungsdelikte
1. Das Schutzkonzept
a) Das abstrakte Gefährdungsverbot im Wirtschaftsstrafrecht als gesetzlich fixierte Maximin-Regel
b) Materielle Anforderungen an abstrakte Gefährdungsverbote
c) Gefahrprognose allein durch den Gesetzgeber
d) Ausschluss der Rückschau
2. Reduktionsbedürfnis des ungefährlichen Einzelfalls
a) Unzulässigkeit teleologischer Reduktionen
b) Einschränkungsmöglichkeit ausschließlich über gesetzlich normierte „persönliche Strafausschließungsgründe“
3. Das „bedingte Gefährdungsdelikt“ als Sonderfall
III. Zwischenergebnis und Konsequenz für den weiteren Gang der Arbeit
C. Anwendung der Trennungsthese auf § 283 Abs. 1 StGB
I. Der situative Kontext der Regulierung: Die Krise
1. Konkretisierung der Krise als außergewöhnliche Entscheidungssituation
2. Konsequenz für die Einordnung des Bankrotts als abstraktes Gefährdungsdelikt?
II. Strafgrund der bestandsbezogenen Gefährdungsalternativen
1. Die herrschenden Auffassungen zum geschützten Rechtsgut der bestandsbezogenen Tatalternativen
a) Schutz der materiellen „Befriedigungsinteressen“ der Gläubiger?
b) Schutz vor „enttäuschtem Vertrauen“?
c) Schutz sonstiger „kollektiver“ Rechtsgüter?
2. Stellungnahme: die bestandsbezogenen Tatalternativen als abstrakte Vermögensgefährdungsdelikte
a) Unzureichende präventive Gläubigerschutzvorschriften des Zivilrechts
b) Der Bankrott als eine Art „Gläubigeruntreue“?
aa) Besondere Verhaltenspflichten des Schuldners in der Krise
bb) Das Schuldverhältnis in der Krise als besonderes Treueverhältnis
cc) Die Gefährdungsverbote des § 283 Abs. 1 StGB als Verfügungsverbote
c) Die einzelnen bestandsbezogenen Tatalternativen als untreueähnliche Pflichtverletzung
aa) § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB
bb) § 283 Abs. 1 Nr. 2 StGB
cc) § 283 Abs. 1 Nr. 3 StGB
dd) § 283 Abs. 1 Nr. 4 StGB
ee) § 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB
ff) Zusammenfassung
d) Unrechtsausschluss durch Einwilligung aller Gläubiger?
3. Zusammenfassung: Hinreichender Unrechtsgehalt der bestandsbezogenen Tatalternativen
III. Strafgrund der informationsbezogenen Tatalternativen
1. Die herrschenden Auffassungen zum Strafgrund der informationsbezogenen Tatalternativen
a) Schutz vor unzureichender Selbstinformation des Schuldners
b) Schutz vor unzureichender Fremdinformation der Verfahrensbeteiligten im Insolvenzverfahren
2.Stellungnahme
a) Einwände gegen die herrschende Meinung
b) Einwände gegen die behauptete Strukturähnlichkeit zu den Urkundsdelikten
c) Die Buchdelikte als Blankettstraftatbestände
d) Die Buchdelikte als Vermögensgefährdungsdelikte?
aa) Buchführungsverstöße gemäß § 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB i.V.m. § 239 HGB
bb) Vernichtung von Unterlagen gemäß § 283 Abs. 1 Nr. 6 StGB i.V.m. § 257 Abs. 1 und Abs. 4 HGB
cc) Bilanzpflichtverstöße gemäß § 283 Abs. 1 Nr. 7 StGB i.V.m. §§ 242, 243 HGB
3. Zusammenfassung: Hinreichender Unrechtsgehalt der informationsbezogenen Tatalternativen in der Krise
IV. Zwischenergebnis nach der Abzugsthese
V. Zur Bedeutung der objektiven Strafbarkeitsbedingung in § 283 Abs. 6 StGB
1. Die objektive Strafbarkeitsbedingung als Zweckmäßigkeitserwägung
2. § 283 Abs. 6 StGB als eine Art „Vorbehaltsklausel“
3. Konsequenz: Verzicht auf einen „tatsächlichen Zusammenhang“
a) Ungerechtigkeit einer vom „tatsächlichen Zusammenhang“ gelösten, zufälligen Strafverschonung?
b) Strafbefreiende Berücksichtigung der Nachholung der Buchführungs-/Bilanzierungspflicht vor Eintritt der Bedingung?
c) Erforderlichkeit einer zeitlichen Beziehung zwischen Handlung und Bedingung?
d) Berücksichtigung der Krisenüberwindung vor Bedingungseintritt?
aa) Berücksichtigung einer Sanierung im Schutzschirmverfahren
bb) Berücksichtigung einer freien Sanierung vor Bedingungseintritt
Читать дальше