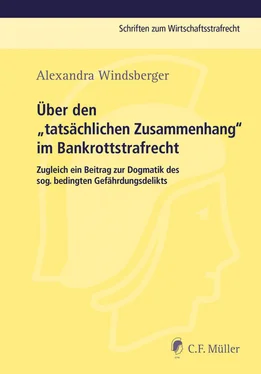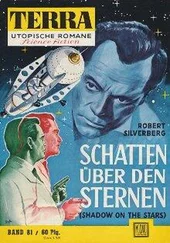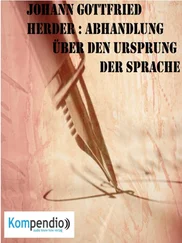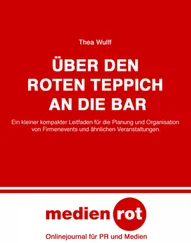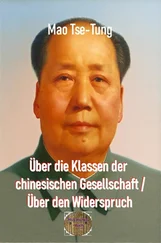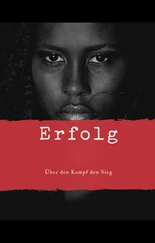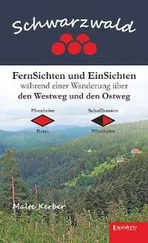Er hat in seiner Betreuung stets das richtige Maß zwischen geistiger Anregung, akademischer Freiheit und wohlwollender doktorväterlicher Strenge walten lassen, wodurch es mir möglich wurde, die an mich gestellten Anforderungen zu bewältigen, ohne mich in zeitlicher oder inhaltlicher Hinsicht zu verlieren. Weit mehr als eine angenehme Pflicht ist es mir, mich bei Herrn Prof. Dr. Heinz Koriath für sein großzügiges Engagement zu bedanken. Er hat mich und diese Arbeit auf vielfältige Weise gefördert und durch zahlreiche Anregungen und geduldige Gespräche das Gelingen der Arbeit wesentlich beeinflusst. Mein Dank gilt ferner den Herausgebern und Professoren Dres. Mark Deiters, Thomas Rotsch und Mark Zöller für die Aufnahme in diese Reihe. Den Herren Prof. Dr. Guido Britz, Dr. Jörg Habetha und Patrick van Bakel danke ich herzlich für die regen Diskussionen und den fachlichen Austausch, auch wenn ich nicht jede ihrer Kritiken berücksichtigt habe. Profitiert habe ich von diesen Streitgesprächen dessen ungeachtet immer. Ein besonderer Dank gilt Frau Dr. Charlotte Schmitt Leonardy für den aufmunternden Zuspruch und ihren ökonomischen Sachverstand, der mir über schwierige Phasen und Fragen hinweghalf. All denen, die das Entstehen dieser Arbeit mit Interesse begleitet haben, möchte ich an dieser Stelle wenigstens in toto sehr herzlich danken. Meinem lieben Freund Stefan Engel danke ich für den technischen Support, den er aus den USA in den Nachtstunden leistete. Ohne die Unterstützung meines geliebten Gatten, die im Einzelnen hier gar nicht hoch genug gewichtet werden kann, wäre diese Arbeit sicher sehr viel schlechter ausgefallen. Die Arbeit wurde mit dem Dr.-Eduard-Martin-Preis 2017 der Universitätsgesellschaft des Saarlandes ausgezeichnet. Saarbrücken im Januar 2017 Alexandra Windsberger
Einleitung
Teil 1 Die dogmengeschichtliche Entwicklung
A. Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Geltungsbereich der Konkursordnung
I. Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Kontext des einfachen Bankrotts
1. Die „Bankrotthandlung“
2. Der Relativsatz „Schuldner, welche (...)“
3. Das Verhältnis zwischen Bankrotthandlung und Konkurs?
4. Die Rechtsnatur des Bankrotts in der Interpretation durch das Reichsgericht
II. Der „tatsächliche Zusammenhang“ in der Interpretation durch die konkursstrafrechtliche Rechtsprechung
1.Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Rahmen des § 210 Nr. 2 KO
a) Die Entscheidung des 1. Senats vom 21.11.1881
b) Die Entscheidung des 2. Senats vom 27.11.1896
c) Zusammenfassung
2. Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Rahmen des § 209 Nr. 4 KO und § 210 Nr. 2, Var. 2 KO
a) Die Entscheidung des 3. Senats vom 8.10.1883
b) Die Entscheidung des 1. Senats vom 8.12.1884
c) Die Entscheidung des 4. Senats vom 1.4.1892
d) Zusammenfassung
3. Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Rahmen des § 210 Nr. 1 KO
a) Die Entscheidung des 4. Senats des BGH vom 8.6.1920
b) Die Entscheidung des BGH vom 20.3.1951
c) Die Entscheidung des 1. Senats des BGH vom 8.5.1951
d) Zusammenfassung
4. Erste Zwischenbetrachtung: Der „tatsächliche Zusammenhang“ als unrechtsbegründender Faktor
a) Der „zeitliche“ Zusammenhang im Rahmen informationsbezogener Bankrotthandlungen
b) Der „sachliche“ Zusammenhang im Rahmen bestandsbezogener Bankrotthandlungen
c) Der „tatsächliche“ Zusammenhang als restringierendes teleologisches Korrektiv?
III. Der „tatsächliche Zusammenhang“ in der Interpretation durch das konkursstrafrechtliche Schrifttum: Zusammenhang zwischen Handlung und Erfolg?
1.Die Frage nach dem geschützten Rechtsgut
a) Zum Stand der Rechtsgüterlehre des 19. Jahrhunderts
b) Das geschützte Rechtsgut der Konkursdelikte
2. Der Relativsatz als Umschreibung der „Rechtsgutsbeeinträchtigung“
3. Zusammenhang zwischen Bankrotthandlung und „Rechtsgutsbeeinträchtigung“?
a) Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „schuldindifferenter äußerer Zusammenhang“ zwischen Handlung und Erfolg?
b) Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „präsumtiver Kausalzusammenhang“?
4. Zweite Zwischenbetrachtung: Der „tatsächliche Zusammenhang“ als verkappter Kausalzusammenhang?
IV. Stellungnahme: Der „tatsächliche Zusammenhang“ als Hilfsmittel einer erfolgsorientierten Auslegung
1.Dogmatische Inkonsistenzen
a) Strafe ohne Schuld
b) Auslegung contra legem
2. Anschlussprobleme
a) Beginn der Strafverfolgungsverjährung?
b) Inkonsistenzen im Bereich der Versuchsstrafbarkeit
c) Inkonsistenzen im Bereich der Teilnahmestrafbarkeit
3. Zusammenfassung
B. Die Verlagerung des Unrechtszentrums auf die Bankrotthandlung: eine Perspektivenverschiebung
I. Der Bankrott als abstraktes Gefährdungsdelikt
1. Unrecht durch abstrakte Gefährdung?
2. Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung als objektive Bedingung der Strafbarkeit?
3. Fortbestand des „tatsächlichen Zusammenhangs“?
II. Würdigung
1. Unangemessene Fixierung von Kriminalität
2. Der einfache Bankrott als Anwendungsfall einer mittelalterlichen Erfolgshaftung?
3. Der „tatsächliche Zusammenhang“ als ungeeignetes Mittel zur Beschränkung einer Erfolgshaftung
III. Der Beginn einer Reform des Konkursstrafrechts
1. Die Einwände der großen Strafrechtskommission gegen das geltende Konkursstrafrecht
2. Dogmatisch-konstruktive Ersetzung des „tatsächlichen Zusammenhangs“ durch eine Umgestaltung der Bankrottdelikte
a) Die Einführung eines konkreten Gefährdungsdelikts
b) Sonderproblem: Die Buchdelikte
3. Stellungnahme: Unzulänglichkeit der frühen Reformvorschläge
a) Die konkrete Gefahr als Surrogat für den Verletzungserfolg?
b) Einwände gegen die Beibehaltung der alten Rechtslage im Rahmen der Buchdelikte
4. Zusammenfassung
IV. Die Versöhnung mit dem Schuldprinzip: Das 1. WiKG
1. § 283 StGB: Der Bankrott im Kontext der „wirtschaftlichen Krise“
a) Die wirtschaftliche Krise als neues unrechtsbegründendes Merkmal
b) Das geschützte Rechtsgut
c) Auffüllen des tatbestandlichen Unrechtsgehalts durch weitere normative Tatbestandsmerkmale
d) Neuverortung des Relativsatzes in § 283 Abs. 6 StGB
2. § 283b StGB: Die Verletzung der Buchführungs- und Bilanzierungspflicht außerhalb der Krise
a) Abstraktes Gefährdungsdelikt außerhalb der Krise
b) Inhalt und Funktion des § 283b Abs. 3 StGB
3. Konsequenz für den „tatsächlichen Zusammenhang“ nach der Gesetzesreform
C. Rückschritt durch Rechtsanwendung?
I. Nichtbeachtung der Bezugsgegenstandsänderung
II. Die Entscheidung des BVerfG zu § 240 KO
III. Die Übertragung des „tatsächlichen Zusammenhangs“ durch die Rechtsprechung in der Bundesrepublik
1.Entscheidungssammlung zum „tatsächlichen Zusammenhang“ im Rahmen des § 283b StGB
a) Die Entscheidung des BGH vom 20.12.1978
b) Die Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 27.9.1979
c) Die Entscheidung des BayObLG vom 8.8.2002
d) Die Entscheidung des BayObLG vom 3.4.2003
e) Der Beschluss des 1. Senats des BGH vom 19.8.2009
f) Die Entscheidung des 1. Senats des BGH vom 13.2.2014
2. Die Anwendung des „tatsächlichen Zusammenhangs“ auf § 283 StGB
a) Die Entscheidung des 3. Senats des BGH vom 23.8.1978
b) Die Entscheidung des 1. Senats des BGH vom 10.2.1981
c) Die Entscheidung des 3. Senats des BGH vom 30.8.2007
3. Ergebnis: Rückschritt durch Rechtsanwendung
IV. Der Lösungsansatz des bankrottstrafrechtlichen Schrifttums
1. Die herrschende Auffassung: Notwendigkeit eines Zusammenhangs zwischen Handlung und Bedingung
a) Der „tatsächliche Zusammenhang“ als sog. „Gefahrrealisierungszusammenhang“
Читать дальше