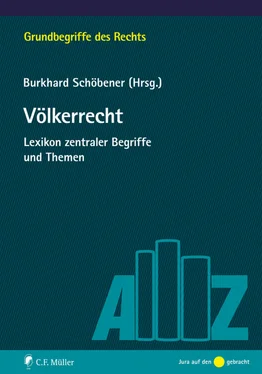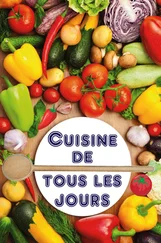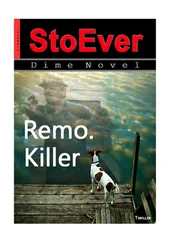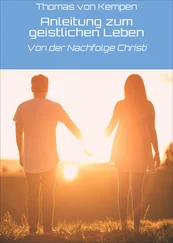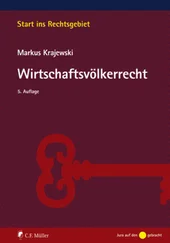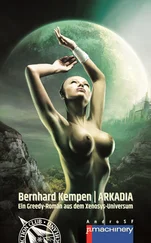III. Verpflichtungen erga omnes?
Verträge zu Lasten Dritter sind unzulässig (Art. 34 WVRK; Sart. II, Nr. 320). Verträge wirken nur inter partes , nicht erga omnes im Sinne von „zu Lasten aller“. Diese Grundregel kennt nur scheinbar Ausnahmen. So wirken die Normen des ius cogens nicht nur erga omnes in dem Sinne, dass ihre Verletzung von allen Staaten geltend gemacht werden kann. Sie binden auch alle Staaten und sonstigen Völkerrechtssubjekte. Diese Wirkung haben die Normen des → ius cogensaber nicht deshalb, weil sie zwingenden Charakter haben, sondern umgekehrt setzt die Entstehung von ius cogens voraus, dass die jeweilige Norm als Vertrags- oder Gewohnheitsrecht alle Staaten bindet, vgl. Art. 53 WVRK. Ähnliches gilt für sog. Statusverträge, d. h. Verträge, die den Status eines bestimmten Gebiets verbindlich regeln sollen (Beispiel: internationaler Status des Suez-Kanals). Über die Vertragsparteien hinaus kann diesen Verträgen eine – gewohnheitsrechtliche – Bindungskraft für all diejenigen zugesprochen werden, die nicht ausdrücklich widersprechen ( acquiescence , → Völkergewohnheitsrecht). Nur in diesem eingeschränkten Sinne lässt sich dann von einer erga omnes-Verpflichtung sprechen. Ähnliches gilt schließlich auch für die Völkerrechtssubjektivität von → Staaten und → Internationalen Organisationen. Ist ein Staat von einigen Staaten als solcher anerkannt worden oder ist eine Internationale Organisation von einigen Staaten ins Leben gerufen worden, so besteht die damit je verbundene Rechtssubjektivität nicht in dem Sinne erga omnes, dass die nicht beteiligten Staaten diese gegen sich gelten lassen müssten, sondern nur im Verhältnis des anerkennenden Staates zum anerkannten Staat bzw. im Verhältnis der Mitgliedstaaten der Internationalen Organisation untereinander.
IV. Abschließende Bewertung
Das Konzept der erga omnes-Pflichten ist von grundlegender Bedeutung für das Verständnis des modernen Völkerrechts. Auch wenn es strukturell das Konsensprinzip nicht verlässt, zeigt es auf, dass sich die Staaten im Wege der Vereinbarung auf gemeinsam geteilte Werte und Überzeugungen eingelassen haben ( → Konstitutionalisierung).
E› Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) (Angelika Nußberger)
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) (Angelika Nußberger)
I. Entstehungsgeschichte
1. Geschichte der Ausarbeitung der Konvention
2. Aufbau der Konvention
3.Vertragliche Weiterentwicklung des Konventionstextes
a) Ergänzung der substantiellen Garantien durch Zusatzprotokolle
b) Änderung der substantiellen Garantien durch Zusatzprotokolle
c) Verfahrensänderungen durch Zusatzprotokolle
II. Inhaltliche Schwerpunkte
1. Vergleich zu anderen internationalen Menschenrechtsverträgen
2. Vergleich zu den Grundrechtskatalogen nationaler Verfassungen
3. Hierarchisierung der Schutzbestimmungen
4. Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung der EMRK
III. Auslegungsmethoden
1. Restriktive Interpretation von Vorbehalten und Erklärungen
2. EMRK als „lebendiges Instrument“
3. Ermessensspielraum
4. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
IV. Wirkung der Entscheidungen des EGMR zur EMRK
Lit.:
E. Bates , The Evolution of the European Convention on Human Rights: From its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights, 2010; C. Grabenwarter/K. Pabel , Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Aufl. 2012; A. Nußberger , Europäische Menschenrechtskonvention, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. X, 3. Aufl. 2012, § 209.
Die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; Sart. II, Nr. 130) ist ein von allen Mitgliedstaaten des Europarats ratifizierter regionaler Menschenrechtsvertrag ( → Menschenrechte, allg.; → Völkervertragsrecht), der aufgrund des darin vorgesehenen effektiven gerichtlichen Kontrollmechanismus Vorbildfunktion für den internationalen Menschenrechtsschutz hat.
I. Entstehungsgeschichte
1. Geschichte der Ausarbeitung der Konvention
Bereits kurze Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es Überlegungen, parallel zu der Ausarbeitung der → Allgemeinen Menschenrechtserklärungvon 1948 auch für Europa ein regionales Instrument zum Schutz der Menschenrechte zu schaffen, das einen Rückfall in Diktatur und Totalitarismus zu verhindern helfen und zugleich den Kern für die Entwicklung einer europäischen Verfassungsordnung bilden würde. Nachdem die Satzung des Europarats am 5.5.1949 in Kraft getreten war, war die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten der erste wichtige völkerrechtliche Vertrag, der unter der Ägide des Europarats ausgearbeitet wurde. 1950 wurde die Konvention von 13 Staaten gezeichnet, 1953 trat sie nach der zehnten Ratifikation in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings eine verpflichtende Kontrolle lediglich durch die Europäische Kommission für Menschenrechte vorgesehen; eine Unterwerfung unter das Individualbeschwerdeverfahren vor dem → Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)war dagegen lediglich eine Option. Dies änderte sich erst 1998 mit dem Inkrafttreten des 11. Zusatzprotokolls, das die Zuständigkeit des Gerichtshofs für alle Vertragsstaaten der EMRK verpflichtend vorschrieb.
Während die Konvention zu Zeiten des Kalten Krieges nur von westeuropäischen Staaten ratifiziert wurde, traten nach der Wende 1989/1990 auch alle mittel- und osteuropäischen Staaten bei, wenn auch zum Teil – etwa die Nachfolgestaaten Jugoslawiens – mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Gegenwärtig sind alle europäischen Staaten mit Ausnahme von Weißrussland und Vatikanstaat Vertragsstaaten der Konvention.
In der Konvention sind in den ersten 18 Artikeln alle geschützten Rechte und Freiheiten sowie auch besondere Einschränkungsmöglichkeiten festgelegt. Im zweiten Abschnitt werden Zusammensetzung und Funktionsweise des EGMR sowie die einzelnen Verfahren, insbesondere das Individualbeschwerdeverfahren, beschrieben. Im dritten und letzten Abschnitt finden sich allgemeine Regelungen zur Abgrenzung zu anderen Verfahren der Streitbeilegung, zu Vorbehalten und zur Kündigung. Während die im ersten Abschnitt enthaltenen materiellen Menschenrechtsgarantien bisher keinen Änderungen unterzogen wurden, wurden die Regelungen des zweiten Abschnitts der geänderten Rolle des EGMR entsprechend mehrfach angepasst.
3. Vertragliche Weiterentwicklung des Konventionstextes
a) Ergänzung der substantiellen Garantien durch Zusatzprotokolle
Bei der Ausarbeitung des ursprünglichen Textes der Konvention konnte man sich nicht auf eine Einbeziehung eines → eigentumsrechtlichen Schutzeseinigen. Eine entsprechende Bestimmung wurde zusammen mit einem Recht auf Bildung und der Verpflichtung, freie und geheime Wahlen durchzuführen, in das 1. Zusatzprotokoll vom 20.3.1952, in Kraft getreten am 18.5.1954, aufgenommen. Mit Ausnahme der Schweiz und Monacos haben alle Mitgliedstaaten des Europarats das 1. Zusatzprotokoll ratifiziert, wenn auch teilweise unter Vorbehalten oder verbunden mit bestimmten Erklärungen, die insbesondere Restitutionsfragen betreffen.
Читать дальше