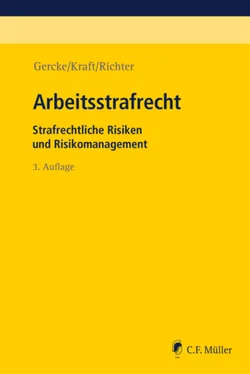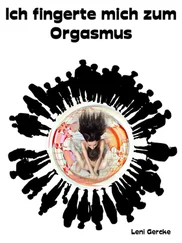b) Mitteilung an Dritte (Abs. 1)
c) Tathandlungen nach Abs. 2
d) Unbefugtheit bzw. Rechtswidrigkeit
2. Strafbarkeit nach § 202a StGB im Falle der Überwachung und Kontrolle der Telekommunikation (Privatnutzung verboten)
a) Der Datenbegriff des § 202a StGB
b) Nicht für den Täter bestimmt
c) Besondere Sicherung gegen unberechtigten Zugang
d) Verschaffung von Zugang zu den geschützten Daten unter Überwindung einer Zugangssicherung
e) Unbefugtheit bzw. Rechtswidrigkeit
3. Strafbarkeit nach § 42 BDSG im Falle der Überwachung und Kontrolle der Telekommunikation
4. Ordnungswidrigkeit nach Art. 83 Abs. 4 und 5 DSGVO im Falle der Überwachung und Kontrolle der Telekommunikation
5. Strafbarkeit nach § 201 StGB im Falle der Telefonüberwachung
V. Postkontrolle
VI. Standortüberwachung durch den Einsatz eines GPS-Senders
VII. Observation durch einen Detektiv/Privatermittler
3. Kapitel Rechtsfolgen im arbeitsstrafrechtlichen Verfahren
A.Strafrechtliche Konsequenzen
I. Einleitung
II. Rechtsfolgen der Tat
1. Strafen
2.Nebenfolgen und Maßnahmen
a) Überblick
b) Berufsverbot
c) Vermögensabschöpfung
aa) Überblick
bb) Vermögensabschöpfung im Arbeitsstrafrecht
cc) Das Unternehmen als Einziehungsadressat
3. Verfahrenserledigung im Wege des Strafbefehls
4. Einstellung gegen Geldauflage (§ 153a StPO)
III. Grundzüge der Strafzumessung
B.Bußgeldrechtliche Konsequenzen
I. Einleitung
II.Die Bemessung von Bußgeldern
1. Bußgeldrahmen und allgemeine Vorschriften
2.Bußgeldbemessung im Einzelfall
a) Zumessungskriterien des § 17 Abs. 3 OWiG
b) Abschöpfung der aus der Tat erlangten Vorteile
III. Geldbuße gegen das Unternehmen, § 30 OWiG
1. Adressat der verhängten Sanktion
2. Voraussetzungen der Verhängung einer Geldbuße
3. Bemessung des Bußgeldes
IV. Geldbuße gegen den Betriebs- bzw. Unternehmensinhaber, § 130 OWiG
1. Täterkreis
2. Tathandlung
3. Anknüpfungstat
4. Bußgeldrahmen
V. Einziehung des Wertes von Taterträgen (§ 29a OWiG)
C. (Zivil- und) Arbeitsrechtliche Konsequenzen
I.Abmahnung und Ermahnung
1. Begriffsbestimmung und Voraussetzungen der Abmahnung
2. Die Abmahnung als Voraussetzung für Kündigungen
3. Die Ermahnung
II. Kündigung
1. Tatkündigung
a)Außerordentliche Kündigung
aa) Allgemeines
bb) Sonderkündigungsschutz
cc) Wichtiger Grund
dd) Kündigung durch Arbeitnehmer
b)Ordentliche Kündigung
aa) Allgemeines
bb) Kündigungsgründe i.S.v. § 1 KSchG
2.Verdachtskündigung
a) Außerordentliche Kündigung
b) Ordentliche Kündigung
III. Freistellung
IV.Vertragsstrafe und Betriebsbuße
1. Vertragsstrafe
2. Betriebsbuße
V.Schadensersatzpflicht
1. Haftung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber
2. Haftung des Arbeitnehmers gegenüber Dritten
3. Haftung bei Auflösungsverschulden
VI. Unterlassungspflicht
VII. Herausgabepflicht
VIII. Ausschluss eines Mitglieds aus dem Betriebsrat und Auflösung des Betriebsrats
1. Grobe Amtspflichtverletzung
2. Verfahren
D. Sonstige rechtliche Konsequenzen
I. Allgemeine zivilrechtliche Konsequenzen
II. Geschäftsführer-/Vorstandsausschluss
III. Sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen
IV.Gewerberechtliche Konsequenzen
1. Eintragung ins Gewerbezentralregister
2. Gewerbeuntersagung
a) Ausübung eines Gewerbes
b) Unzuverlässigkeit
V.Vergabe- und wettbewerbsrechtliche Konsequenzen
1. Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge nach § 21 Abs. 1 S. 1 SchwarzArbG
2. Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge nach § 21 Abs. 1 S. 1 AEntG
3. Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge nach § 19 Abs. 1 MiLoG
4. Mangelnde Eignung als Bewerber bei öffentlichen Auftragsausschreibungen für Bauleistungen (§ 6a Abs. 2 Nr. 5–9 VOB/A)
5. Eintragung ins Wettbewerbsregister
VI. Steuerrechtliche Konsequenzen
VII. Beamtenrechtliche Konsequenzen
E. Faktische Konsequenzen
I. Negative Publizität
II. Störung des inneren Betriebsfriedens
III. (Außerrechtliche) wirtschaftliche Nachteile
IV. Resümee
4. Kapitel Die Vertretung von Arbeitgebern in (Arbeits-)Strafverfahren
A. Präventivberatung des Arbeitgebers
I. Einleitung
II. Begriff und Zielsetzung der Compliance
III. Rechtsgrundlagen der Compliance
1. Pflichten der Geschäftsleitung, § 43 GmbHG, § 93 AktG
2. Straf- bzw. ordnungsrechtliche Organisationspflichten
3. Anforderungen an die Compliance-Organisation
a) Risikoanalyse
b) Mission Statement
c) Organisation
aa) Organisation im engeren Sinne
bb) Inhaltliche Organisation – das Compliance-Regelwerk
d) Training und Kontrolle
aa) Präsenzschulungen und E-Learning
bb) Kontrollmaßnahmen
e) Dokumentation
B. Grundzüge der Verteidigung von Unternehmen und Unternehmensverantwortlichen (in Arbeitsstrafsachen)
I.Mandatsaufnahme
1. Klärung der eigenen Kompetenzen
2. Klärung der Interessenlagen – Vertretung des Unternehmens und/oder einzelner Verantwortlicher?
3. Klärung der Mandatsmodalitäten
4. Festlegung der Mandatsziele
II.Erste Schritte
1. Bestellung gegenüber Ermittlungsorganen und ggf. sonstigen Behörden
2. Etwaige Anzeige ggü. Versicherungen
3. Informationsbeschaffung und -aufbereitung
4. Verteidigung in Arbeitsstrafsachen: Zwischen Konflikt und Kooperation
C. Grundzüge der Beratung von Arbeitgebern als Opfer von Straftaten
I. Erste Schritte
1. Rechtsbeistand
2. Sachverhaltsermittlung
II.Arbeitsrechtliches Vorgehen
1. Abschließende Anhörung des verdächtigten Arbeitnehmers
2. Entscheidung über arbeitsrechtliche Maßnahmen
III.Strafrechtliches Vorgehen
1. Die Kernfrage: Erstattung einer Strafanzeige?
a) Pflicht zur Strafanzeige?
aa) Zivilrechtliche Pflicht
bb) Untreue bei unterlassener Strafanzeige?
b) Unzulässigkeit einer Strafanzeige?
aa) Strafrechtliche Konsequenzen
bb) Zivilrechtliche Konsequenzen
cc) Kostenrechtliche Konsequenzen
c) Vor- und Nachteile einer Strafanzeige
d) Inhalt der Strafanzeige
e) Einreichung der Strafanzeige
2. Rechte und Pflichten des geschädigten Unternehmens im Strafverfahren
a) Rechte des Arbeitgebers als Opfer von Straftaten durch Arbeitnehmer
aa) Informationsrechte
bb) Akteneinsichtsrecht
cc) Mitteilung des Verfahrensausgangs
dd) Partizipationsrechte
ee) Vermögenssicherung im Strafverfahren für den Arbeitgeber
ff) Anknüpfungspunkte für Schadenswiedergutmachung im Strafverfahren
b) Pflichten des Arbeitgebers
aa) Duldung von Zwangsmaßnahmen
bb) Zeugenvernehmungen
D.Kostentragung von strafrechtlicher Beratung und Verteidigung
I. Einleitung
II.Übernahme der Rechtsschutzkosten
1. Rechtsschutzkosten
2. Kostenerstattung nach Auftragsrecht
3. Anspruchsvoraussetzungen
4. Anspruch auf Vorschussleistungen
5. Endgültige Kostenübernahme
6. Kostentragung trotz Vorliegens einer Pflichtwidrigkeit
7. Umfang der Kostenübernahme
8. Kostenübernahme durch D&O-Versicherungen
9. Steuerrechtliche Konsequenzen
III.Übernahme von Geldsanktionen
1. Geldstrafen und -bußen
2. Geldauflagen
3. Steuerrechtliche Aspekte
Stichwortverzeichnis
Vorwort Vorwort Fünf Jahre sind seit dem Erscheinen der letzten Auflage vergangen. Die umfassende Überarbeitung und Ergänzung des Werks zog sich durch immer wieder neue Gesetzesänderungen und nicht zuletzt durch teils fundamentale Änderungen in der Rechtsprechung länger als erwartet hin. Dies zeigt aber auch die stetig zunehmende Bedeutung des Arbeitsstrafrechts und seine geradezu rasante Entwicklung. Wesentliche Gesetze wurden – teilweise grundlegend – neu gefasst, wie etwa das Arbeitnehmerentsendegesetz, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und insbesondere gleich mehrere einschlägige Normen durch die zahlreichen Änderungen im Zuge des Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat gerade im Bereich des § 266a StGB bemerkenswerte Entscheidungen getroffen, nicht zuletzt zur Verjährung, in der die Richter des BGH nunmehr der Ansicht der Autoren folgen, wie sie hier seit der 1. Auflage konsequent vertreten wird. Mit Blick auf den hoch speziellen Bereich des strafbewehrten Arbeitnehmerdatenschutzes haben wir uns dazu entschlossen, Herrn Kollegen Dr. Andreas Grözinger aus Köln in den Autorenkreis aufzunehmen. Für die tatkräftige Unterstützung möchten wir uns bei Herrn Dr. Christopher Czimek, Frau Dr. Tatjana Hahn, Frau Dr. Diana Hembach, Frau Rika Lömke, Frau Dr. Corinna Reckmann sowie Frau Anna Schreynemackers bedanken. Unser Dank gilt weiterhin dem C.F. Müller Verlag und dort insbesondere Herrn Datow, der dieses Projekt seit langem wohlwollend begleitet. Schließlich gilt unser besonderer Dank unseren Kolleginnen und Kollegen in unseren jeweiligen Kanzleien sowie insbesondere unseren Familien, die uns unermüdlich unterstützen und die zusätzlichen zeitlichen Belastungen weiterhin (er-) tragen. Köln und Mönchengladbach, November 2020. Rechtsanwalt Prof. Dr. Björn Gercke Rechtsanwalt Dr. Oliver Kraft Rechtsanwalt Dr. Marcus Richter
Читать дальше